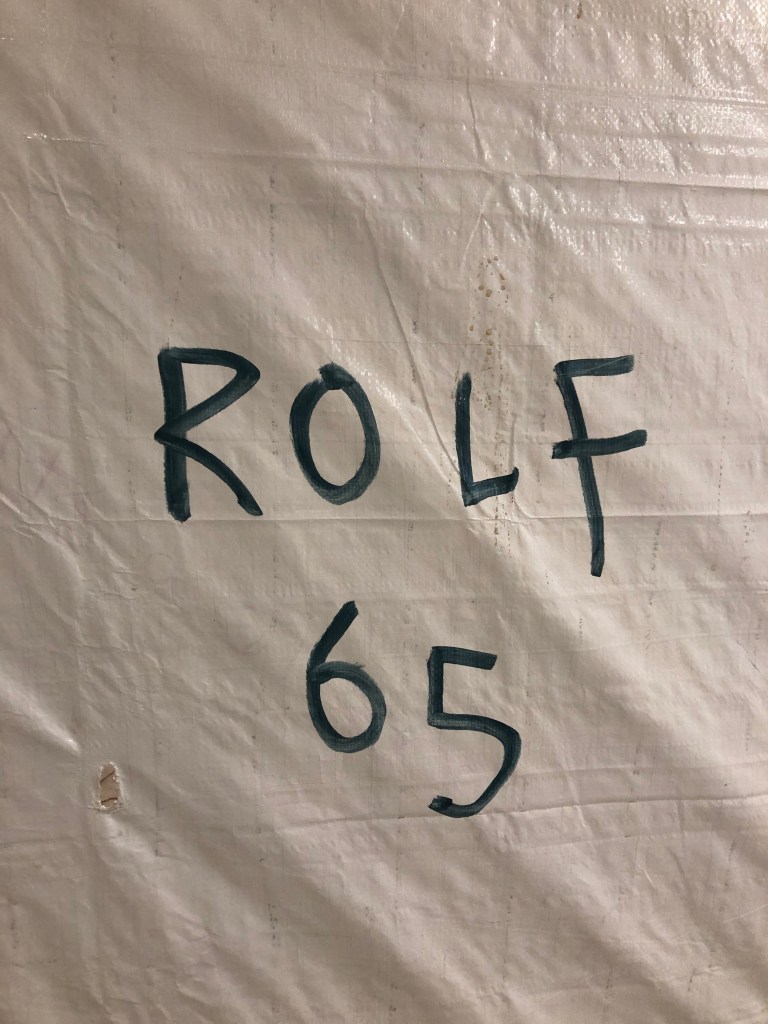Die Stimmung war gut. Mein Bruder hatte uns mit seinem alten Mercedes zum Bahnhof gefahren, wir waren damit prima das Ahrtal hinunter gekommen, hatten meinen Jungs die verlassenen Weinberge gezeigt, die wir damals statt einer Rodelbahn hinuntergebrettert waren und hatten noch Zeit für einen Kaffee auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Jungs bekamen ein Eis. Wir hatten ein paar Tage in einer Jugendherberge in meiner alten Heimat hinter uns und die Morgensonne schien freundlich und mild. „Ich könnt mir gut vorstellen hier als Rentner jeden Morgen meinen Kaffee zu trinken.“, schwärmte ich in neu erwachter Heimatliebe. „Es gibt schönere Orte auf der Welt.“, grinste mein Bruder, der die Welt gesehen hat und nun als abgemusteter Seebär seit ein paar Jahren versucht, unser kleines Elternhaus zu seiner neuen Heimat zu machen. Und er hatte Recht. Es war nicht nur die Schönheit des Augenblicks, die mich an den alten Ort fesselte, es war auch die Angst vor dem, was noch vor uns lag. Mein Bruder mag alle Stürme der sieben Weltmeere durchpflügt haben, ich dagegen wage immer wieder eine Fahrt von Bonn nach Berlin mit der Deutschen Bahn und zwei Kindern. Was sich harmlos anhört war in den vergangenen Jahren stets zum finalen Abenteuer unseres Urlaubs geworden. Und auch dieses Jahr sollte uns die Bahn nicht enttäuschen, nein sie sollte, das ahnte ich wohl, sich diesmal selbst übertreffen. Und was wir noch nicht wussten: Sie hatte sich dazu neue Verbündete gesucht.
Wie immer wiegte sie uns am Anfang in Sicherheit. Der ICE kam fast pünktlich, die Plätze waren reserviert und es sollte nur viereinhalb Stunden dauern. Wir saßen in einem „Sprinter“, das Flotteste, was die Bahn zu bieten hat. Und wir schafften es auch ohne Probleme bis nach Köln, sogar bis fast bis zum Hauptbahnhof, als es in einer Rechtskurve auf dem Dach schepperte. Wir standen schräg, rechts eine Schallschutzwand, links ein hoher Bahndamm und nichts ging mehr. Der schlaksige Zugführer, der die samtene rote Zugführerbinde lässig am nackten Unterarm trug, als sei sie nicht Zeichen seiner Herrschaft und Sorge über die Reisenden, sondern die Eintrittskarte zu einem Strandclub, lief ein paar mal schweigend an uns vorbei. Auch die Fahrgäste schwiegen und blickten vor allem in ihre Handys. Was muss in Deutschland passieren, damit die Menschen in einem Zug miteinander reden? Nach einer halben Stunde wurde ich aufgenommen in die Schicksalsgemeinschaft, die sich virtuell gebildet hatte. Ob ich den neusten Gossip hören wolle, fragte mich die Hochschwangere neben uns. Die Oberleitung sei gerissen und auf den Zug gefallen. Die ganze Außenhülle des Zuges stehe also unter Strom wie in einem Farradayschen Käfig. Keiner könne raus. Türen und Fenster dürfen nicht geöffnet werden. Gleichzeitig fehlte der Strom für die Klimaanlage. Wir waren gefangen. Durch eine dünne Glasscheibe vom blauen Himmel und der frischen Sommerluft getrennt. Als die Temperaturen stiegen, fragten meine Jungs mich, ob wir jetzt ersticken müssten. In meiner Not deutete ich auf die vielen kleinen Löcher in der Deckenverkleidung. Da käme die Luft raus, fabulierte ich und hoffte inständig, dass die Ingenieure bei Siemens an sowas wie eine Zwangsbelüftung gedacht hatten, die auch ohne Strom funktioniert. Sicher war ich mir nicht. Vielleicht war genau daran gespart worden. Als die Durchsage kam, dass das Bordbistro für umsonst Getränke ausgibt, wusste ich, dass die Lage ernst wurde. Ich schickte die Jungs Cola holen und sie kamen mit reicher Beute zurück. Ab da war ihr Sportsgeist geweckt. Nach zwei Stunden kam der Schaffner ins saunawarme Abteil mit der Nachricht, die Feuerwehr hätte eine Notrampe den steilen Bahndamm hoch gelegt. Aber nur für Leute, die körperlich fit seien, außerdem rutsche die Rampe, sodass nur noch wenige über sie gehen könnten. Titanicfeeling. Das letzte Rettungsboot hing schräg in den Seilen. „Das ist doch nicht steil, das schaffen wir locker.“, entschieden die Zwillinge für mich mit einem Blick aus dem Fenster. Ich ließ mich von ihrem Elan mitreißen. Das Glück ist mit den Tapferen. Alte Männer und Kinder zuerst. Wir verabschiedeten uns von der Schwangeren, der man einen Umstieg in einen anderen Zug versprach und enterten die wacklige Reeling, die von der Kölner Feuerwehr gesichert wurde. Viel Mut brauchte es tatsächlich nicht. Wie schön das Industriegebiet von Köln-Zollstock sein kann. Unter einer rostigen Brücke versammelten sich die Geretteten und sofort fing das Gezänk an. Der versprochene Bus kam nicht, ein paar Taxis waren heiß umkämpft, irgendwelche Zettel mussten ausgefüllt werden. Gezeter, wer zuerst da war und wer es am Nötigsten habe. Eine Feuerwehrfrau gab uns den Tipp, dass ein paar Hundert Meter weiter eine Straßenbahn Richtung Hauptbahnhof abfährt. Brauchten wir Fahrkarten? Blöde Frage. „Isch fahr schwatz mit der KVB, die Markfuffzich dät denen doch net weh…“ Das war „Zeltinger“, Kölscher Punk aus den Achzigern. Endlich war es soweit. Ein Jugendtraum erfüllt sich. Ein Alptraum auch. Denn die Bahn, die jetzt kommt, ist so alt wie der Song und in Köln fährt die Straßenbahn zum Dom unterirdisch. Kurz vor Neumarkt blieb sie mitten im Tunnel stehen. Mit Kölscher Gemütlichkeit erzählt der Fahrer uns Verlorenen, dass die Elektrik nicht funktioniert. Er werde jetzt mal alles ausschalten und hoffen, dass sie wieder anspringt. Es wurde dunkel und unheimlich still. Wir stehen in der Röhre, schwitzende Leiber aus dem ICE um uns, nur die Displays der Handys leuchten gespenstisch (meine Söhne behaupten später, viele hätten gelacht, als die Durchsage des Fahres kam). Beim nächsten Mal, gelobe ich in meinem Innern, werde ich ganz regulär eine Fahrkarte kaufen und im Dom eine Kerze anzünden für St. Christopherus, den Heiligen, der das Christuskind über einen reißenden Fluss trug…. Das Licht ging wieder an und die Bahn ruckelt weiter. Am nächsten Bahnhof brauchen die ächzenden Falttüren beim Öffnen einen Augenblick zu lange, um mein Vertrauen in die Technik wieder herzustellen. Panisch verlasse ich mit den Kindern den Zug, haste durch das mit stumpf schlurfenden Menschenleibern vollgestopfte Unterweltreich und treibe meine Jungs die nächste Treppe hoch. Endlich Licht! Luft!
„Ui jui jui!“ , scherzt der Schaffner, der im nächsten ICE eine Erklärung verlangt, warum wir seinen Zug benutzen, wie eine schlechte Horst Evers-Parodie, „Da haben sie ja ein kleines Abenteuer erlebt. Da können sie zu Hause ja was erzählen.“ Im Bordbistro gibt es für die Jungs ein Eis kostenlos. Das nächste Mal fahre ich mit dem Schiff.