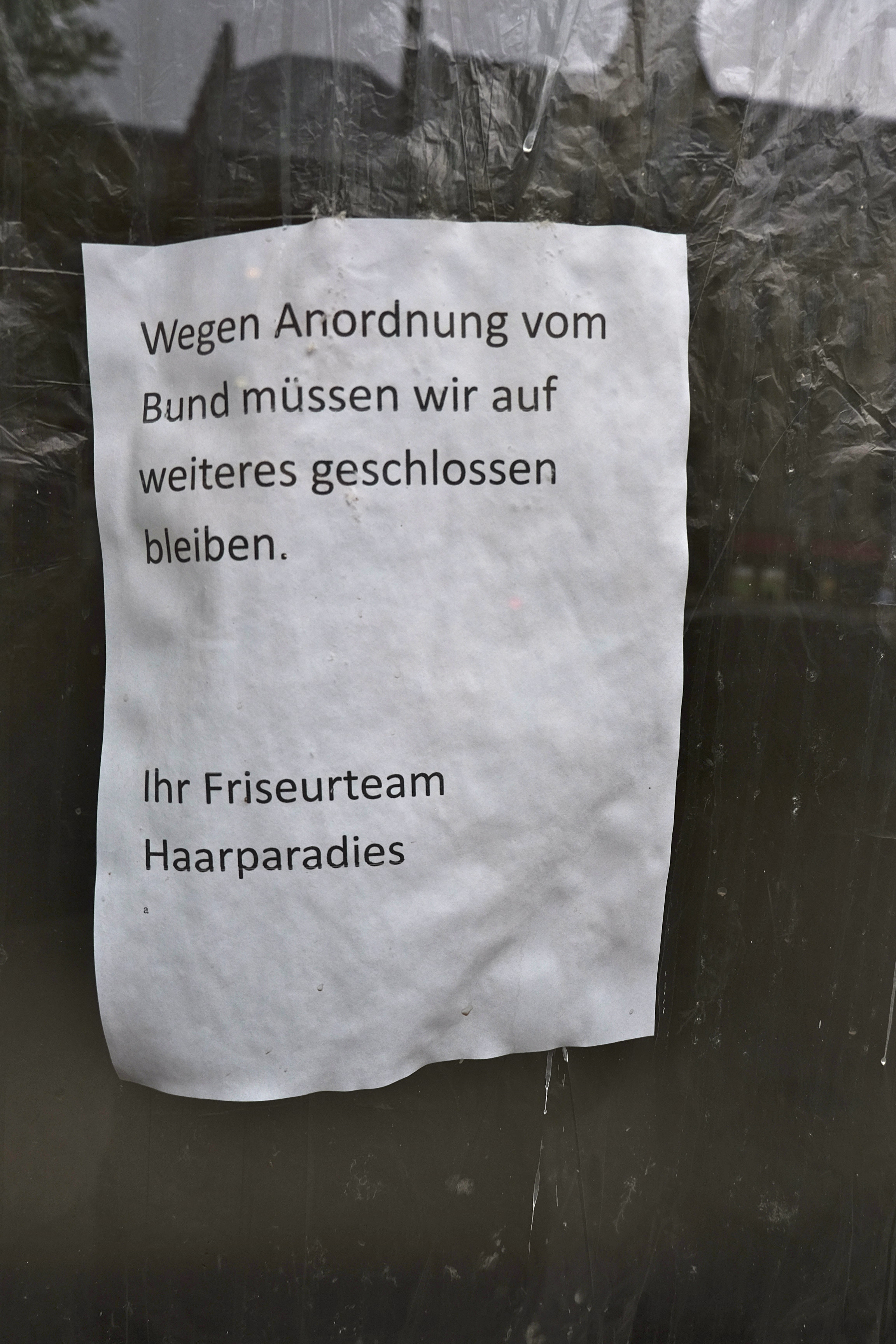Es gibt so viel schmierige Werbung mit Familienglück in den Weihnachtsbeilagen, die langsam wieder anfangen, die Zeitungen dick zu machen, dass ich fast krank werde davon. Diese Zeitungen, die auf Seite 3 das Schicksal der ärmsten dieser Welt brilliant und einfühlsam beschreiben und dann in der Hochglanz-Magazinbeilage eleganten Designer-Schnick-Schnack für die Münchner Stadtvilla präsentieren. Natürlich auch im redaktionellen Teil. Und auf der Rückseite, in dezentem Schwarz-Weiß gehalten immer wieder Werbung für teure mechanische Armbanduhren. Und man sieht den Mann in den besten Jahren, erfolgreich aber sportlich elegant, mit so einer Schweizer Luxuszwiebel am Handgelenk, wie er seinem wie aus dem Ei gepellten Sohn, den er wahrscheinlich gerade vom Internat abgeholt hat, freundlich und wissend zulächelt. „Eine Patek Phillipe gehört einem nie ganz allein… eigentlich bewahrt man sie nur für die nächste Generation.“
Ist das nicht wunderbar? Das ganze Jahr dem Shareholder Value die letzten Resourcen und das Klima zu opfern, aber von den vielen Talern, die dabei raussspringen sich eine ganz nachhaltige Uhr zu kaufen, die hoffentlich wasserdicht ist, damit Sohnemann später auch in überfluteten Landstrichen weiß, was die Stunde geschlagen hat.
In unserer Familie lief das mit der Übergabe vom Vater auf den Sohn anders.
Vatter war mal wieder auf Tour und Mutter wahrscheinlich im Keller, in der Waschküche. Ich war sechs oder sieben und stromerte durch die leere Wohnung. In der Nachttischschublade meines Vaters fand ich drei goldene Uhren: Für 100 000 unfallfreie Kilometer, für 250 000 unfallfreie Kilometer und für 500 000 unfallfreie Kilometer. Ein goldener Löwe glänzte auf dem Ziffernblatt. Das Markenzeichen der Firma Büssing aus Braunschweig. Der Braunschweiger Löwe eben, der auch auf dem Kühlergrill des LKW prangte, mit dem mich mein Vater ab und zu mitnahm. Die Uhren überzustreifen und den Sandkastenfreunden zu zeigen, war eins. Leider kamen sie aus der Buddelkiste nicht wieder so strahlend heraus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Eine hatte ich wohl auch verschenkt. Erstaunlicherweise bekam ich kaum Ärger deswegen. Vielleicht, weil sie schon kaputt waren als ich sie fand, es waren ja eigentlich nur Werbegeschenke, oder weil sich mein Vater aus Armbanduhren nichts machte, weil er in seinem Führerhaus einen Fahrtenschreiber hatte, der präzise jede gefahrene Minute aufzeichnete (und von dem er wusste, wie man ihn manipulieren konnte, um noch mehr Überstunden zu machen), oder vielleicht, weil er schon die Uhr für eine Million unfallfreie Kilometer mit goldenem Flex-Armband am Handgelenk hatte. Es wurde mir verziehen und der Liebe Gott persönlich schenkte mir zur 1. hl. Kommunion eine kleine Junghans mit hellem Zifferblatt und Leuchtziffern, mit denen ich mich stundenlang unter der Bettdecke beschäftigen konnte. Und die Faszination blieb.
Für manche Männer sind Uhren ein Zeichen, das ihren Erfolg im Leben zeigt. Für mich sind sie ein Instrument, Männerherzen zu öffnen. Das geht schöner und subtiler als mit Fußball und Autos oder Alkohol. Als ich nach dem Abitur ein Praktikum auf einer Männerstation machte, hatten meisten Männer ihre Armbanduhren an den Bettgalgen gehängt, um Platz zu schaffen für die Nadeln und Kanülen in ihrem Unterarm. Ein Hinweis auf die schöne Uhr und die Frage, woher sie die denn hätten, und schon erzählten sie eine Lebensgeschichte. Hochzeit, Krieg, der verstorbene Vater… Einmal bekam ich auch von einem jüdischen Patienten eine Lektion fürs Überleben im KZ. Ich hab sie mir gemerkt. Denn damals, als Franz Josef Strauß Bundeskanzler werden wollte, war noch nicht klar, auf welcher Seite des Stacheldrahts wir Langhaarigen und Schmeißfliegen hinterher landen würden. Der Uhren-Trick klappt fast immer. Ob bei garstigen Vorgesetzten oder skeptischen Schwiegervätern und später bei der Arbeit als Journalist war er ein Türöffner zu sehr verschlossenen Quellen. Vielleicht auch, weil die Kerle auf meiner Seite echte Leidenschaft spürten.
Denn seit den Löwen- und Leuchtziffernerlebnissen war ich auf der Suche nach der idealen Uhr. Sie sollte aussehen wie eine der Löwenuhren meines Vaters, eine Stoppuhr musste sie haben, Wasserdicht musste sie sein und schlagfest (wie die Timex, die in der Fernsehwerbung immer auf einer Faust durch eine Glasscheibe geschlagen wurde). Unerreichbar schienen die berühmten sowjetischen Uhren, die sogar einen eingebauten Wecker haben sollten. Und was die Uhren von James Bond alles konnten…. Keine Frage: Der Besitz der richtigen Uhr war so lebensentscheidend wie der Besitz eines Schweizer Offiziersmessers. Und das Drama meines Lebens spielte sich deswegen bei einem windigen Antiquitätenhändler in einem Kölner Hinterhof ab. Er hatte die Uhr meiner Träume, eine Schweizer Fliegeruhr aus den 40ern, so eine, bei der die gelbliche Leuchtziffernfarbe noch aus radiokativem Material war, also ewig strahlte. Aber ich hatte die 400 Mark nicht, die er dafür wollte und er war beinhart wie ein Dealer. Eine Woche später hatte ich das Geld, aber die Uhr war weg.
Der Rest meines Lebens hatte seither praktisch nur ein Ziel: Die Suche nach dieser Uhr. Auf jedem Flohmarkt Berlins, auf den Polenmärkten der Nachwendezeit bis nach Sankt Petersburg, wo in den bitteren Jelzin-Jahren Armeechronografen und Pistolen auf dem gleichen Tisch verkauft wurden. Immer wieder kaufte ich eine, immer wieder war ich überzeugt, es wäre jetzt die richtige – und immer wieder wurde ich enttäuscht. Entweder merkte ich, dass doch ein ganz wichtiges Merkmal fehlte oder die alten Dinger gingen einfach kaputt. Was mich wiederum zu endlosen Rettungsveruchen bei skurrilen Uhrmachermeistern oder noblen Schweizer Läden auf der Friedrichsstraße brachte. Man kann nicht nur von Babybäuchen Ultraschalluntersuchungen machen, sondern auch von Uhrwerken. Geht aber nicht auf Krankenkasse.
Eine Zeitlang sah es so aus, als könnte die Liebe meine Krankheit heilen. Als ich meiner Freundin verkündete, dass ich jetzt, um meine Pein zu beenden, mein Sparbuch auflösen wolle, um mir für mehrere tausend Euro eine nagelneue Schweizer Uhr zu kaufen, bangte sie nicht nur um die Zukunft des werdenden Lebens, das sie unter dem Herzen trug, sondern auch um meine geistige Gesundheit.
Und sie tat etwas sehr Kluges.
Sie schenkte mir ein Seminar einer Uhrenmanufaktur, bei dem ich mir selber eine Uhr bauen konnte. War ich bisher am idealen Äußeren der Uhren verzweifelt, konnte vielleicht ein Blick in die wahren Schönheiten, die bekanntlich innen wohnen, mich von meinem Fluch befreien. Und so schraubte ich ein Wochendende unter der strengen Zucht eines Uhrmachermeisters der ehmaligen Bundesbahn an einem filigranen Schweizer Werk herum. Erst auseinanderbauen, dann zusammenbauen, dann kalibieren. Es war ein berauschendes Erlebnis, als ich die Unruh einsetzte und das Werk zu pulsieren begann. Ich war geheilt! Keine andere Uhr sollte mehr mein Herz verstören, als die, die ich selbst geschaffen hatte.
Leider vermag die Kraft der Liebe nichts gegen den Lug und Trug in dieser Welt. Nach ein paar Jahren fing nicht nur die Beziehung an zu knirschen, sondern auch das Uhrwerk. Der letzte Meister der Zeit, den ich aufsuchte sah tatsächlich aus wie Einstein und verkaufte nebenher Comics. Er setzte seine Lupe auf und murmelte etwas von „asiatischen Teilen“, die sich schnell abnutzten. Das war das Ende.
Alles was von meiner Odyssee geblieben ist, ist ein schwarzer Schuhkarton in meinem Schrank, der voll ist mit kaputten Uhren und vielen vergilbten Reparaturrechnungen, die mit Tinte von feiner Uhrmacherhand geschrieben wurden.
Letztes Wochenende hatte ich vergessen, den Schrank abzuschließen, in dem der Friedhof meiner Träume lagert. Meine Jungs zogen den Karton hervor und hatten großen Spaß mit den Glanzstücken, die mir mal alles bedeutet hatten. Ich holte eine Ahle aus dem Werkzeugkasten und stach in die Armbänder ein Loch, damit sie um die dünnen Handgelenke passen. Ich erklärte ihnen, wie man eine Uhr stellt und wie man sie aufzieht. Als ich sie zurück zu ihrer Mutter brachte prahlten sie mit dem, was sie von Papa gekriegt hatten. Da zog der Älteste, der bei seiner Mutter geblieben war, ein langes Gesicht, was mich natürlich traurig machte. Also streifte ich meine letzte funktionierende Uhr ab, eine Casio, die mich mal in der Altstadt von Ankara angefunkelt hatte, und band sie ihm ans Handgelenk.
Das Ideale ist, keine Uhr mehr zu haben, aber drei strahlende Jungs.