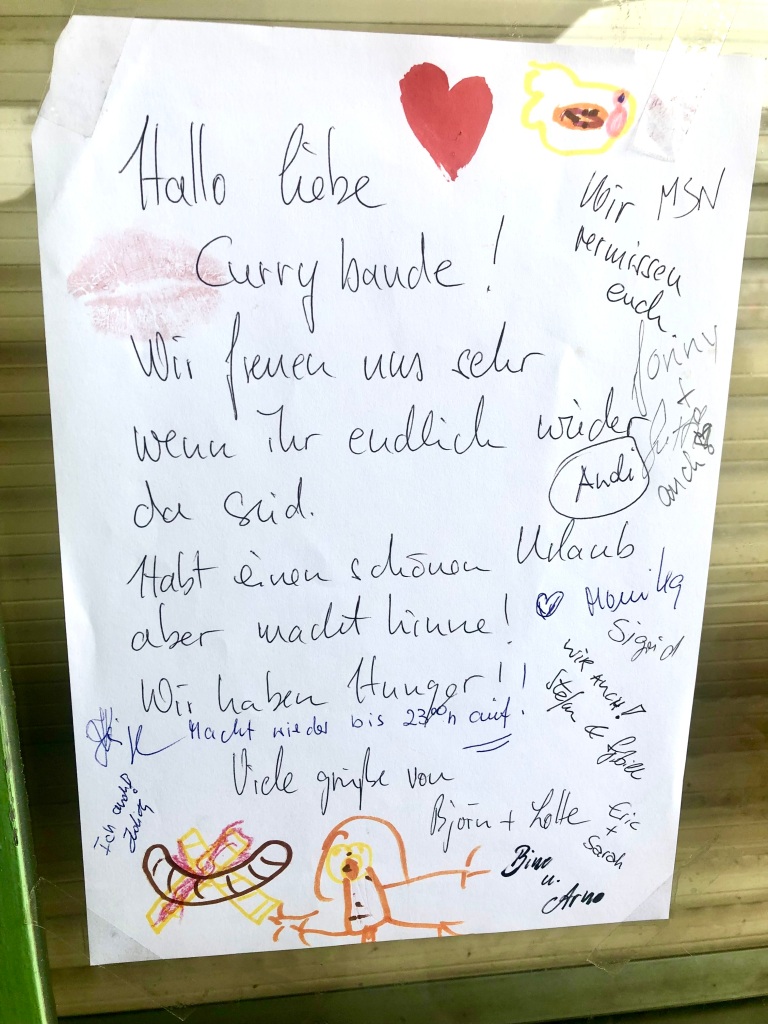Schon oft habe ich mir auf diesem Blog Sorgen um ihn gemacht, dachte, er wäre ein Opfer der Klimakrise geworden und habe ihm sogar ein aufmunterndes Gedicht auf den Weg gegeben. Es sah wirklich schlecht für ihn aus, von draußen: die Farbe abgeblättert, die Auslage verstaubt und dann war auch noch auf einmal ein Ladenfenster leer geräumt. Aber man soll sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Und vor allem: Man soll nicht immer das Schlimmste denken. Und überhaupt: Wenn du denkst, es geht nicht mehr… Genau. Und so ist es auch hier ganz anders als befürchtet. Weder sind böse Kapitalisten im Spiel, noch wollen Hippster die Bude übernehmen. Es geht einfach weiter mit dem alten Laden, dem Laden mit den Madenautomaten, der so was wie ein Markenzeichen des Wedding geworden ist, und der bürgerlich „Angelhaus Koss“ heißt. Der Laden, an dem ich morgens immer auf dem Weg zur Arbeit vorbei komme. Und jetzt habe ich mich sogar getraut mal rein zu gehen und für unser Kiez-Magazin zu fragen, wies denn geht, und so. Und so einiges mehr. Und dabei habe ich viel darüber erfahren, dass Angler ganz anders sind als man denkt, dass das Internet nicht alle kleinen Läden kaputt macht und ich habe seit langem mal wieder einen sehr entspannten Menschen kennen gelernt: Alexander, den Mann hinter dem Madenautomaten. Der Herr der Fliegen, sozusagen.
Wird es weitergehen mit dem Angelhaus?
Ja, es wird weitergehen. Wir mussten einen Teil des Ladens räumen, weil das Haus grundsaniert werden muss. Es steht auf einer „Torfblase“. Das Gebiet wurde früher zum Torfstechen genutzt. Zuerst dachte man, dass das Haus komplett geräumt werden muss, aber jetzt könnten wir theoretisch wieder zurück in den alten Laden. Aber wir haben uns dafür entschieden, den Teil unseres Geschäftes, den für die Wetterkleidung, zu räumen und zu renovieren. Jetzt ziehen wir langsam hier rüber. Bis wir fertig sind, wird es noch eine Weile dauern. Aber wir werden wieder unser volles Sortiment anbieten: Angelgeräte, Wetterkleidung und Pokale.
Für einen leerstehenden Laden in der begehrten Gegend gibt es wahrscheinlich viele Interessenten.
Bei uns hat jeden Tag jemand nachgefragt, ob er den Laden haben kann. Ich habe auch nichts gegen die Veränderung im Kiez. Es gibt hier einen guten Zusammenhalt und man hilft sich untereinander.









Gibt es denn noch genug Kundschaft für einen so speziellen Laden?
Wir sind einer der wenigen Angelläden in Berlin, die noch durchhalten. Viele sind schon weggestorben oder haben aufgegeben. Unsere Kunden kommen aus ganz Berlin und Brandenburg. Der Beratung wegen. Aber auch, weil man eine Angelrute oder eine Spule in der Hand gehabt haben muss, bevor man sie kauft. Und wir sind sehr bekannt in Anglerkreisen in Ost- und Westberlin. Als die Mauer aufging, wussten die Angler aus dem Osten genau, wo sie hingehen mussten.
Wandern nicht immer mehr Kunden ins Internet ab?
Wahrscheinlich. Aber wir kriegen auch junge, neue Kunden, die sich YouTube-Videos angeschaut haben und dann genau die eine High-Tech-Rute haben wollen, die sie im Internet gesehen haben. Mit einem Stock, einer Schnur und einem Korken, wie wir damals angefangen haben, fängt heute keiner mehr an. Alle wollen Raubfische angeln und an verschiedenen Plätzen angeln. Mir ist das recht. Wenn die Youngster 300 Euro für eine Rute anlegen wollen, können Sie die bei mir bekommen. Aber wir haben auch günstigere Angebote.
Einen echte Veränderung haben auch die Wetter-Apps gebracht. Wenn die Kunden sehen, dass es am Wochenende regnet, bleiben sie zu Hause.
Gibt es denn auch noch die schweigsamen älteren Männer, die sich alleine an den Kanal stellen – das alte Angler-Klischee?
Zum Angeln muss man nich Schweigen. Das ist ein Gerücht. Aber ja, es sind meistens Männer, die angeln. Durch alle Schichten hindurch. Arbeitslose, Sportler oder Ärzte. Aber es werden auch immer mehr Frauen. Gerade in der Coronazeit sind mehr Frauen gekommen. Die meisten angeln aber mit Ihrem Partner.
Kann man in Berlin überhaupt noch angeln?
Es wird einem schon schwer gemacht. Man muss eine Prüfung ablegen, um einen Fischereischein zu bekommen und braucht eine Angelkarte von dem Pächter des jeweiligen Gewässers. Für den Plötzensee werden seit vergangenem Jahr keine Angelkarten mehr ausgegeben. Man kann sich natürlich auch an das Ufer des Nordhafens stellen. Das mache ich auch manchmal. Aber wenn es Starkregen gibt, sterben die Fische in den Kanälen oft massenhaft, wegen der Abwässer, die in die Kanäle abfließen, wie neulich im Landwehrkanal. Dann ist der Kanal voll mit toten Fischen. Und in Brandenburg ist es im Sommer an den Seen schwer noch ein ruhiges Plätzchen zu finden, wegen der Badetouristen. Da kann man sich dann nur noch mit einem Boot weiter helfen. Angler haben eben keine gute Lobby.
Sie sind jetzt 63 Jahre alt. Wie lange werden Sie weiter machen?
Weiß nicht. Ich weiß nur: Wenn ich hier aufhöre, bin ich in einem Jahr tot.
Und den Madenautomaten, wird es den auch weiter geben?
Ja, er klemmt nur immer öfter, weil irgendwelche Leute Plastikscheiben oder Sonstwas in den Münzschlitz stecken. Und wir füllen ihn nur noch am Wochenende. Die Maden leben ja. Und bei der großen Hitze verpuppen sie sich schneller. Dann haben sie statt Köder irgendwann ganz normale Stubenfliegen in der Schachtel. Das sind oft ganz dicke Brummer.