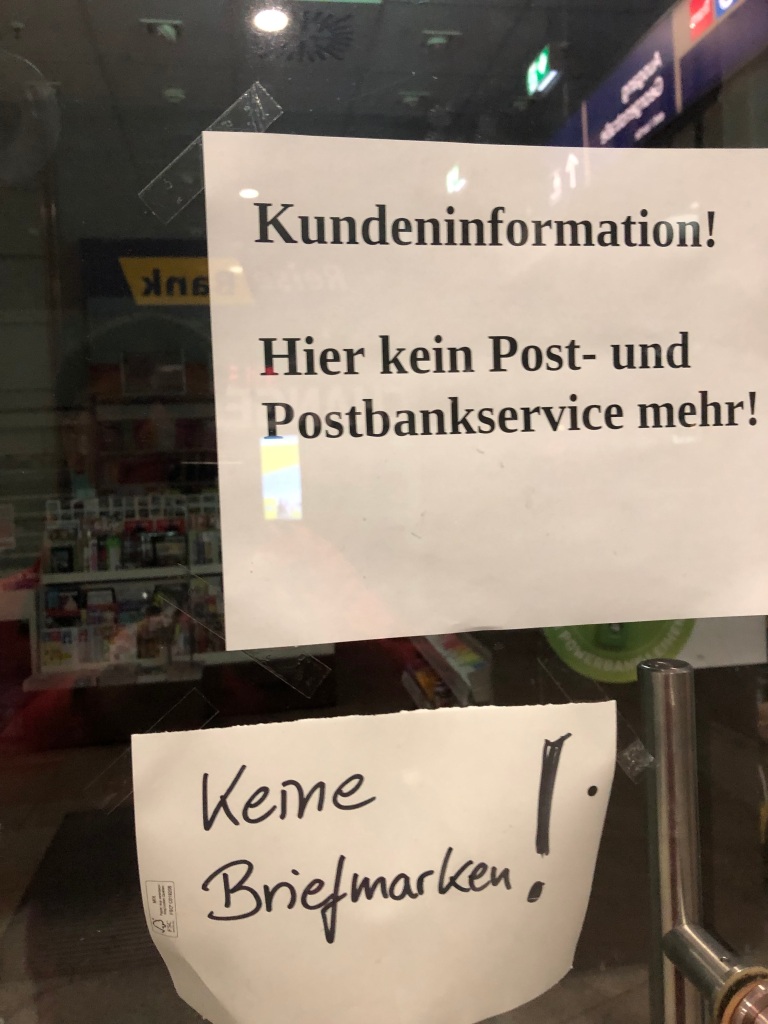Es ist halb elf nachts und es ist still. Vor einer Stunde sind die automatischen Jalousien runtergegangen. Der bellende Husten aus dem Kinderzimmer meines Ältesten hat sich gelegt und das letzte „Ping“ von meinem Handy hat mir die Nachricht gebracht, dass die Mutter meiner Söhne gut da angekommen ist, wo sie dieses Wochenende hin wollte. Ich bin allein. Die Seele meiner Mutter ist auch nicht bei mir, so allein bin ich. Die Stille eines einsamen freistehenden Einfamilienhauses flirrt in meinen Ohren. Oder ist es das Rauschen meines Blutes? Die elektrische Spannung, die meine unnützen Gedanken erzeugen? Oder ist es die Spannung, die meine Gedanken elektrisch aufläd? Ruhig bleiben! Zum Kühlschrank gehen und sehen, dass niemand hier an ein Bier für mich gedacht hat. Ich bin ja auch kein Babysitter, ich gehöre ja zur Familie. Ist da was mit dem Kühlschrank? Dieses leise wimmernde Geräusch. Wie ein schleifender Keilriemen. Haben Kühlschränke Keilriemen? Oder ist es der Geschirrspüler? Oder der Brandenburger Wind, der an den Jalousien rüttelt? Habe ich die Türen abgeschlossen? Ist da jemand? Einen Augenblick bereue ich, dass ich mein Fahrrad nicht in den Schuppen gestellt habe, als ich kam. Jetzt ist es zu spät. Warum denke ich jetzt an mein Fahrrad und nicht an meine drei arglos schlafenden Kinder? Hatte mir nicht vor zwei Tagen ein Freund von einer Einbruchserie in seiner Nachbarschaft erzählt? Von umherziehenden Räuberbanden sprach die Polizei, um ihn zu beruhigen. Das hätte System und würde sich nicht gegen ihn persönlich richten. Welch ein Trost. Nach draußen zu schauen, traue ich mich nicht mehr. Und das Geräusch ist wieder da. Es klingt müde, kläglich und unendlich traurig. Kaum wird es etwas schneller, ebbt es schon wieder ab. Um wieder langsam und kraftlos anzufangen. Wie ein müder alter Sysiphos. Nie habe ich etwas hoffnungsloseres gehört. „Gagari“, denke ich. Nicht Gagarin sondern Gagari, darauf hatte mein Jüngster bestanden. Gagari, Cosmi und Goldi. Die drei Mäuse, die meine Söhne vor zwei Jahren von ihrer Mutter geschenkt bekommen haben. Was war das plötzlich für ein Leben in der Bude. Ein Jauchzen und Kosen und „Guck mal“. Das Laufrad im koffergroßen Käfig mit den drei flotten Mäusen stand nicht still. Es jaulte bis nachts wie ein Turbolader. Aber das Herz von Mäusen schlägt schnell. Und unsere Lebensspanne wird in Herzschlägen gezählt. Da gehts den Mäusen wie den Menschen. Ich weiß nicht wen es zuerst dahinraffte, und wer die Maus war, von der mein Ältester nach Hoffen und Bangen im Vorzimmer des Tierarztes Abschied nehmen musste. Ich weiß nur, dass diese Maus, die jetzt in dem viel zu großen Käfig, aus Langeweile oder Einsamkeit noch einmal versucht das eingerostete quietschende Laufrad zu drehen, dabei einen Ton traf, der mich so traurig machte als käme er von einem traurigen, heruntergekommenen Geiger.
Im Käfig ist jetzt Ruhe. Dafür wird das Husten von oben wieder stärker. Ich glaub, ich muss mal schauen gehen.