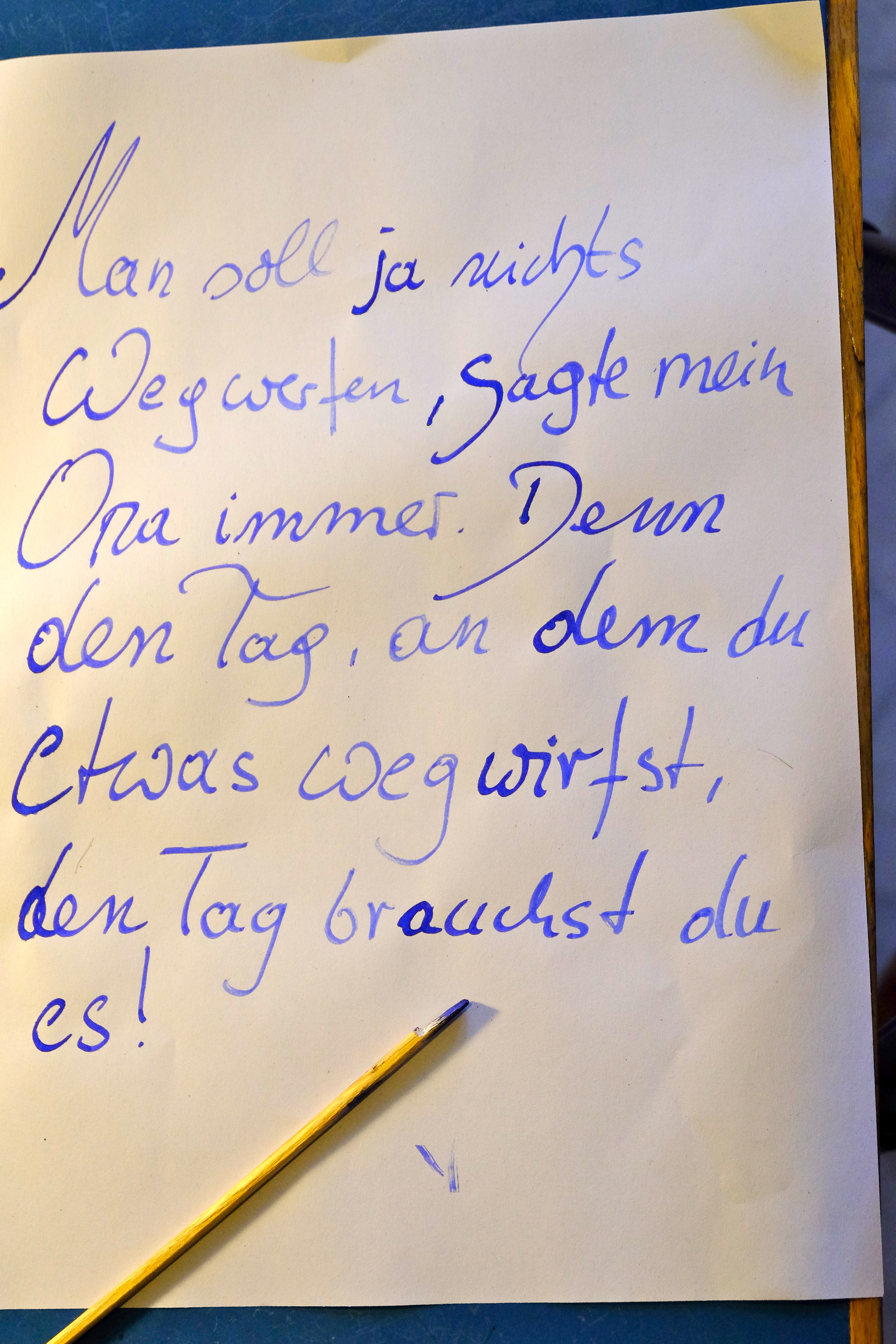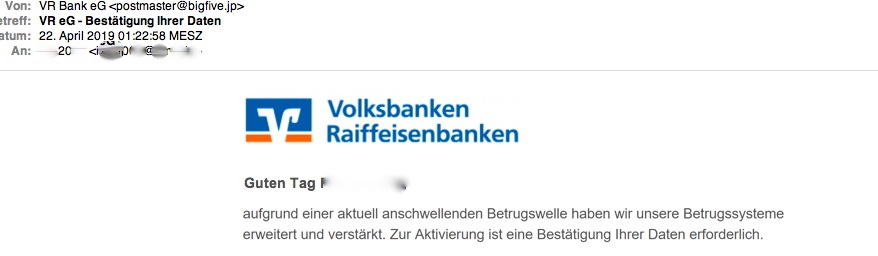Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde von Kafkaontheroad – Lords, Romans, Countrymen: Dieser Blog ist jetzt drei Jahre alt. Darüber freue ich mich sehr. Er wird von mehr als hundert Menschen gelesen, worunter sich eine erhebliche Anzahl von Katzenliebhaberinnen und Hobbyköchen befinden. Seid willkommen.
Vor drei Jahren sagte mein kluger Freund Thomas: Schreib mal einen Blog und dann schau mal nach ein- zwei Jahren. Du wirst dich wundern, wie sich das, was du schreibst verändert hat. Recht hatte er.
Und zur Feier des Tages enthülle ich das lang gehütete Geheimnis:
Wie mein Blog zu seinem Namen kam.
Es war eine Fahrt von Berlin nach Freiburg in einem geliehenen Auto mit meiner Tochter, die mich (die Fahrt, nicht die Tochter) meine wenigen verbliebenen Nerven kostete. Daraus wurde einer der ersten Blogbeiträge. Heute würde ich weniger paranoid und weniger dramatisch schreiben. Und vielleicht bin ich weniger paranoid und einfach ein wenig gelassener – wäre ja ein schöner Erfolg.
Aber überzeugt euch selbst. Hier die kafkaeske Geschichte im ungekürzten Original:
Kafka On The Road
Flughafen Berlin-Tegel, morgens früh um Sieben. Ich habe ein Auto gemietet. Ich will meine Tochter mitsamt dem komprimierten Inhalt ihrer Berliner Teenagerhöhle in ein Studentenwohnheim in Süddeutschland verfrachten. Es ist ein herrlich sonniger Herbsttag. Doch in meinem Herzen ist Finsternis.
Ich habe Angst vor anonymen, übermächtigen Institutionen. Nicht vor der NSA oder dem MAD – wieso sollten die sich für mich interessieren? Aber wenn ich im Internet einen Mietwagen buche, online, also ohne mit einem Menschen gesprochen zu haben, dann ist es mir, als begäbe ich mich in die Hände einer riesigen bösartigen Organisation, ein Moloch mit 1000 hinterlistigen unqualifizierten, unwilligen Mitarbeitern, die nichts anderes im Sinn haben, als sich das Leben leicht und mir schwer zu machen. Sie nehmen einfach mein Geld, schicken mir eine PDF. Und dann stehe ich am Schalter und es stellt sich heraus, dass das alles nichts gilt, dass meine Buchung nicht im System ist und die feisten Angestellten stellen sich dumm. – und ich stehe da, weiß nicht was ich machen soll und mein Geld bekomme ich nie wieder zurück…
Ehrlich gesagt ist mir das noch nie wirklich passiert. Eigentlich ist immer alles gut gegangen, mal abgesehen von dem Kleinbus, damals in Heidelberg, der plötzlich eine Delle im Dach hatte, aber das ist eine andere Geschichte…. Selbst in der Türkei haben sie unser verdrecktes Auto, das wir im fliegendem Wechsel fünf Minuten vor dem Abflug abgegeben haben anstandslos zurückgenommen. Aber was heißt das schon? Gleich heute kann die Bosheit des Systems zuschlagen – und du bist für immer erledigt!
Ich bin fast pünktlich, aber nervös. Ich wollte schon vor einer halben Stunde anrufen, dass ich 10 Minuten zu spät komme- keiner geht ran. Drei Mal habe ich den Lageplan der Autovermietung nachgeschaut. Aus einem unerklärlichen Grund sieht es für mich so aus, als sei Vermietungsstation am Berliner Flughafen eine abgelegene Baracke, die quasi unauffindbar, ganz weit weg vom Flughafen liegt. Das machen sie extra, damit nur Eingeweihte und erfahrene Reisende sie finden. Und wer nicht pünktlich erscheint, dessen Auto geben sie ganz fix jemand anderem. Das steht bestimmt in einer ganz klein gedruckten Einverständniserklärung, die ich irgendwo angeklickt habe – und dann kommt es, wie ich es schon immer befürchtet habe: Das Auto ist weg und meine Tochter steht mit ihren Kartons und Plastiktüten voller H&M Kram im Regen und schimpft mich einen Dummkopf. Bin ich ja auch, hätte ja alles lesen können. Aber das Buchen im Internet ist mir so unangenehm, dass ich es möglichst schnell hinter mich bringen will…
Natürlich interessiert es niemand, ob ich zu spät komme. Kaum bin ich am Flughafen, werde ich geblendet von Wegweisern zur zentralen Autovermietung. Eine Treppe runter und ich bin da. Wären ja auch schön blöd, wenn sie es anders machen würden. Wollen ja Geld verdienen, schließlich. Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Also jetzt vor dem Schalter: Vor mir lässige Nordeuropäer mit ihrem souveränem Englisch -Weltreisende -whow. Ich bin noch ganz klein vor Neid, als mich die adrette Frau hinter dem Schalter heranbittet. Ruck zuck geht das. Schon habe ich ein Vertragsformular vor der Nase, dass ich in dem blinden Vertrauen unterschreibe, dass die geschäftige Freundlichkeit der Frau für den Bruchteil einer Sekunde in mir geweckt hat. Jetzt habe den Autoschlüssel in der Hand und gleich um die Ecke steht der Wagen. Ein nagelneuer Golf. Den darf ich jetzt haben.
Wenn ich nur wüsste, wie ich ohne Kratzer aus dem Parkhaus komme. Und dann die Stadt und erst die Autobahn! 19 Jahre habe ich meine Tochter mit Liebe beim groß werden begleitet, und jetzt setze ich leichtfertig ihr Leben aufs Spiel. Soll ich ihr nicht lieber eine Zugfahrkarte kaufen und ihre Wohnungseinrichtung mit einer Spedition hinterherschicken? Mit einem richtigen Lastwagen und Leuten, die richtig fahren können?
Die ganze Fahrt lang passierte: Nichts! Mit jedem Kilometer wuchs die Zuversicht. Bald flog ich mit 160 dem Süden entgegen. Töchterchen hatte das iPhone angeschlossen und den Navi programmiert. Ich folgte der süßen, verständnisvollen Stimme und meine Beifahrerin lobte meine entspannte Fahrweise. Angekommen in Freiburg lief alles super. Das Zimmer war schön, die Sachen schnell verstaut, und schon am ersten Abend feierte meine Tochter mit einer Flasche Campari beim Zimmernachbarn, während ihr alter Vater auf der Iso-Matte schlief.
Doch das System konnte mich nicht vergessen haben – das wußte ich. Unweigerlich nahte der Tag, da ich das Auto wieder abgeben musste. Noch stand es vor der Tür, im frischen Lack und unbeschädigt. Doch wer weiß, was am nächsten Tag noch alles geschehen würde? Ich würde in die Stadt fahren, in der winzigen Innenstadt einen Parkplatz finden müssen und die Unversehrtheit meines Gefährts im Gewühl gegen hunderte unberechenbare Autofahrer verteidigen müssen. Und dann die Rückgabe! Einige Kratzer waren schon im Übergabeprotokoll vermerkt, aber sicher würde der akribische Bedienstete der Vermietung mehrfach um das Fahrzeug zirkeln, weitere Schäden entdecken, um sie mir dann unter zu schieben. Ich fragte mich, ob ich einen guten Anwalt kenne, mir fiel aber keiner ein.
Golden schien die Herbstsonne auf mein makelloses Auto, als ich schweißgebadet auf den Hof der Vermietung fuhr. Sauber stellte ich es in Blickweite des Vermietungsbüros ab und ging tapfer durch die Tür, um mich der Übergabeprozedur zu stellen. Mit halbem Auge linste ein junger Landenschwengel hinter seinem Computer hervor. „Schlüssel und Papiere bitte.“ Pflichtschuldig reichte ich ihm das Gewünschte. Drei, vier Klicks später murmelte er: „Alles ok, vielen Dank“ und wollte nichts mehr von mir wissen. Benommen verabschiedete ich mich und torkelte ins Freie. War’s das jetzt? Das kann doch nicht alles gewesen sein? So viel Vertrauen habe ich mir immer erträumt, aber nie für möglich gehalten. Glückliches Baden Württemberg! Ist im Süden wirklich alles entspannter? Soll ich nicht einfach hier bleiben?
Mein Glücksgefühl währte nur kurz. Schon in der Straßenbahn zum Bahnhof überlief es mich siedend heiß: Ich habe ja gar nichts in der Hand! Kein Übergabeprotokoll, kein Nachweis, dass ich das Auto überhaupt abgegeben habe. Der Jungspund hatte mich übers Ohr gehauen, war jetzt wahrscheinlich mit dem Auto schon über die französischen Grenze und verscherbelte es dort um sich dann hinterher dumm zu stellen: „Ein Auto? hab ich nie gekriegt.“ Nur mit äußerster Anstrengung gelang es mir, nicht die Notbremse zu ziehen. Und ich weiß bis heute nicht, was mich davon abgehalten hat, im Laufschritt zurück zu rennen, um mir von der Vermietung eine gesiegelte Urkunde ausstellen zu lassen, die mir amtlich bescheinigt, dass das Auto wieder wohlbehalten in den Händen seines Eigentümers ist, und dass ich an keinem Schaden Schuld trage.
Es hätte mir alles nicht genutzt. Denn ich hätte wissen müssen, dass sie es mir nicht so einfach machen. Ich hatte ganz vergessen, dass das Grausame im System nicht mit Absicht, sondern aus Dummheit begangen wird.
Eine Woche später war immer noch kein Zeichen da. Keine Abrechnung, keine Mail, nichts. Ich hielt diese brennende Ungewissheit nicht mehr aus. Ich wollte wissen, was mit dem Auto war und wie viel ich jetzt zahlen muss. Ich hatte schon gegoogelt, was ein neuer Golf kostet und überschlagen, wie viel von meinem Ersparten ich wohl schnell dafür zusammenkratzen könnte. Immer wieder hatte ich die Webseite der Vermietung besucht. Sie versprach mir höhnisch jedes mal, dass ich schon nach 48 Stunden meine Rechnung herunterladen könne, doch nie konnte sie eine Rechnung finden. Natürlich, die feisten Gesellen in der Zentrale wollten ihren Triumph auskosten. Sie wussten, dass ich nichts in der Hand hatte, um mich gegen ihre dreisten Forderungen zu wehren, die sie jetzt genüsslich in die höchsten Höhen schraubten würden. In meiner Not rief ich die Hotline an.
Warteschleife, Knacken, dann eine Begrüßung in einem Deutsch, das die Weiten des Ostens klingen ließ. Sie sitzen also im Osten,… (wo sich ja immer die Zentralen des Bösen verstecken). „Ihre Rechnungsnummer bitte, forderte die dunkle Frauenstimme. Dann Tastaturgeklapper, Straßengeräusche. Wo war ich? Mit wem sprach ich? „Ihre Rechnung ist noch nicht fertig, kam es mit dem harten Akzent von der anderen Seite der Leitung, „es gibt da ein … Problem.“ Es durchfuhr mich, als hätte ich statt des Telefons ein Starkstromkabel in der Hand. Ich war zum Problem im riesigen, weltumspannenden Netz dieses Unternehmens geworden, und ich wusste, wie solche Organisationen mit Menschen umgehen, die ihnen Probleme machen. „Welches Problem?“ fragte ich zaghaft. „Ich kann das heute nicht mehr klären, kam die ebenso zaghafte Antwort, „wir sind in Ungarn und es ist Feiertag. Wir schicken Ihnen morgen eine Mail.“ Ungarn also. War das die neue Filale von „Russisch Inkasso“? Ich hatte noch 24 Stunden Zeit, in denen ich mich entscheiden konnte, ob ich vor den bezahlten Häschern fliehe, oder ob ich mich einfach tot stelle und auf die winzig kleine Chance hoffe, dass das System mich vergisst….
Ich habe nie eine Mail bekommen. Ich habe auch nie eine Rechnung bekommen. Nach zwei Wochen erhielt ich einen kleinen Brief, dessen Absender ein Briefzentrum in Belgien war. Er enthielt einen Verrechnungsscheck über 70 Euro.
Jetzt warte ich darauf, dass das System merkt, dass es sich geirrt hat. Sie werden mich nicht vergessen – das weiß ich.