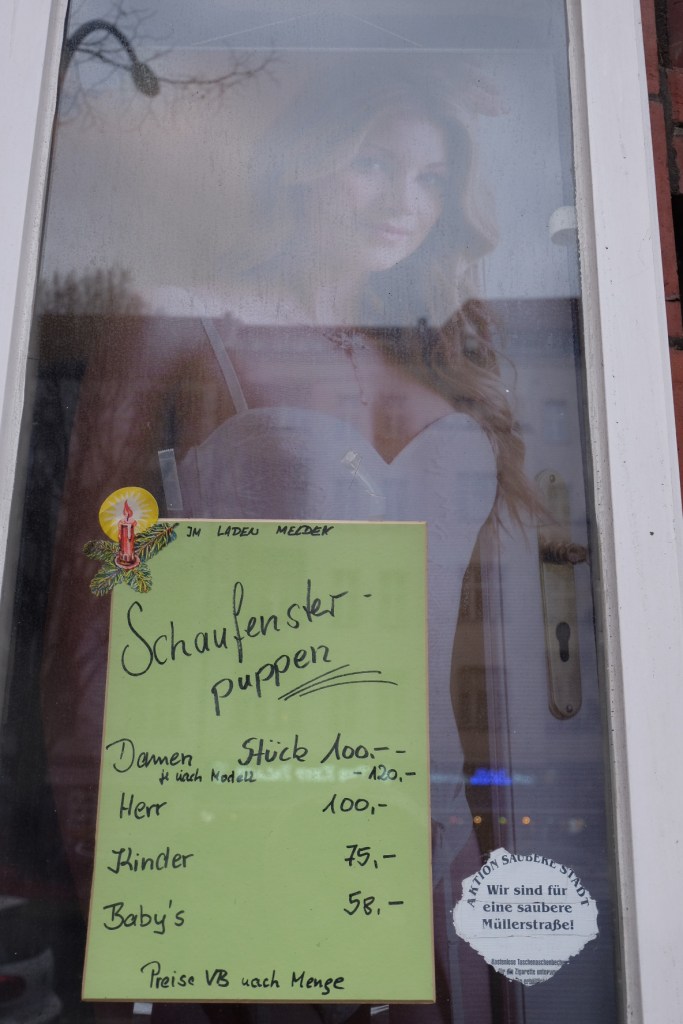Wenn die größte Immobilienfirma Deutschlands eine Pressemitteilung heraus gibt, in der von „Gleichheit und Gerechtigkeit“ die Rede ist, dann muss da was faul sein. Dann kann man das auch als Feierabendjournalist nicht so stehen lassen. Und da ich ja gerade genug Tagesfreizeit habe, wurde ich von der Redaktion unseres Kiezmagazins „Weddingweiser.de“ losgeschickt in die Nachbarschaft, wo die denkmalgeschützte Friedrich-Ebert-Siedlung zwischen Müllerstraße, rotem Efeu und Rehbergepark langsam verfällt. Meinen Jüngsten habe ich dabei im Schlepptau: Ich habe ihm eine Fotosafari versprochen.
Die stille Usambarastraße träumt an diesem strahlenden Spätherbsttag von besseren Tagen. Wer die schmale Straße durch den großen Toreingang von der Petersallee betritt, merkt, dass hier die Zeit langsamer vergeht als auf der Müllerstraße oder der Afrikanischen Straße, die den östlichen Teil der Friedrich-Ebert-Siedlung umschließen. Kaum Verkehr, kein Lärm von den tosenden Magistralen des Wedding, viele alte Bäume und ein leerer Kinderspielplatz. Alle Häuser sehen hier gleich aus: Grau, vier- oder fünfgeschossig und sehr in die Jahre gekommen. Manche schon von Efeu überwuchert, mehr geflickt als renoviert.
Dabei war die Siedlung einmal der Stolz sozialer Wohnungspolitik in der Weimarer Republik. Das rund 100.000 Quadratmeter große Gelände wurde im Jahr 1928 von dem Bau- und Sparverein „Eintracht“ erworben. Vorher standen hier Hüttensiedlungen, die wegen der großen Wohnungsnot von den Bewohnern illegal errichtet wurden. Gustav Bauer, der ehemalige sozialdemokratische Reichskanzler, war einer der beiden Vorsitzenden der Eintracht und legte mit Louise Ebert, der Witwe von Friedrich Ebert, 1929 den Grundstein.
Mit dem architektonischen und städtebaulichen Konzept für die 1.400 Wohnungen wurden die beiden Architekten Paul Mebes und Paul Emmerich sowie der Stadtplaner Bruno Taut beauftragt. Taut hatte vorher unter anderem die Schillerparksiedlung im Wedding entworfen, die heute UNESCO-Weltkulturerbe ist. Auf diese Liste der fünf Berliner Weltkulturerbe-Siedlungen hat es die Friedrich-Ebert-Siedlung nicht geschafft, was vielleicht an ihrem bedauernswerten Zustand liegt. Dabei hat sie Einmaliges zu bieten. Die Wohnhäuser wurden erstmals in der Zeilenbauweise errichtet, das heißt, dass die kurzen und fensterlosen Seiten der langgestreckten Gebäude zur Straße gerichtet und die Hauseingänge durch kleine Fußwege zu erreichen sind.
„Gleichheit und Gerechtigkeit“ sollte durch diese Bauweise symbolisiert werden, schreibt die Wohnungsgesellschaft Vonovia, der 365 Wohnungen im Viertel gehören, in einem Pressetext. Sie schreibt auch etwas von „fast bürgerlich vorstädtischem Flair“. Meint sie das ernst?






Eine niedrige dunkelbraune Tür mit abgenutztem Lack steht offen. Durch sie betrete ich ein Treppenhaus, das im Parterre mit edlen Solnhofener Muschelkalkplatten ausgelegt ist, dem Goldstandard der Vorkriegszeit. An der Kellertür wird das „Betreten mit offenem Licht“ verboten, in einem Alukasten hängt schief eine Mitteilung der Deutsche Wohnen AG. Ein Stockwerk höher liegt auf der Treppe ausgetrocknetes, schartiges Linoleum. Die Decke zum Speicher hat einen Wasserschaden, der auch auf den türkisen Wänden des Treppenhauses goldbraune Schlieren hinterlassen hat. An einer reparierten Wohnungstür hängt ein Strohkranz mit den Worten „Home“. Keine Frage: Der westliche Teil der Friedrich-Ebert-Siedlung zwischen Afrikanischer- und Müllerstraße ist auf den ersten Blick mehr ein „Lost Place“ als ein Bürgertraum, ein von seinen Eigentümern vergessener Ort. Aber wer ist eigentlich der Eigentümer?
„Wir wissen schon gar nicht mehr, wer hier alles Eigentümer war: Gagfah, Fortress, ZVBB, GSW. Und jetzt Deutsche Wohnen”, klagte ein Mitglied einer Mietergruppe, die sich vor Jahren gegen den Verfall engagiert hatte. Den Eigentümern gemeinsam sei, dass kaum einer von ihnen etwas zur Instandhaltung beigetragen habe. In vielen Hauseingängen hängt die Hausordnung der Deutschen Wohnen AG (deren Aktien zu mehr als 86 Prozent der Vonovia gehören). Die Warnschilder auf dem wieder eröffneten Kinderspielplatz tragen das Logo der Vonovia. Es ist etwas verwirrend. Am Zustand der Häuser östlich der Afrikanischen Straße lässt sich der Eigentümer auf jeden Fall nicht ablesen. „Da laufen keine größeren Arbeiten“, bestätigt ein Sprecher der Vonovia. „Und es sind weder von der Deutschen Wohnen noch von der Vonovia größere Sanierungsarbeiten geplant.“







Westlich der Afrikanischen Straße kommt ein weiterer Eigentümer ins Spiel: Die ambelin GmbH aus Berlin wird mir von einem Anwohner genannt. Ob sie es war, die die wenigen Häuserzeilen um das Friedrich-Ebert-Denkmal vor Jahren wieder in ihren strahlend weißen Originalzustand versetzt hat, hätte ich gerne gewusst, aber die Firma antwortet nicht auf meine Anfrage.





Am besten, man blendet das ganze Hin- und Her einfach aus, so wie Herr S., ein älterer Herr, den ich an einem der wenigen Autos treffe, die hier stehen. Seit 1940 lebt er „bei der Eintracht“, obwohl sich der Verein schon Ende der 1990er Jahre auflösen musste. Im Alter von zwei Jahren ist der heute 85-Jährige mit seinen Eltern in die Siedlung gezogen und hier geblieben. 620 Euro warm zahlt er für 70 Quadratmeter und ist zufrieden. Er gehört zu der schnell wachsenden Gruppe der über 80-Jährigen, die im Afrikanischen Viertel und rund um die Rehberge nach Zählung des Bezirkes wohnen. „Voll in Ordnung“, sei es hier, bestätigt auch Herr T, ein quirliger Endzwanziger mit Nickelbrille und dezenten Tatoos am Hals. Sein zierlicher Hund zieht an seiner Leine, während er mir erzählt, dass er vor einem Jahr hier eingezogen ist und 635 Euro warm für eine renovierte Wohnung mit 58 Quadratmetern zahlt. Er ist gekommen, um zu bleiben – wie viele hier. Die Fluktuation liege bei etwa drei Prozent im Jahr, gibt die Vonovia an.
Eine große Treue zum Quartier rund um die Rehberge bestätigen auch die Zahlen des Bezirks aus dem Jahr 2021. Aber so langsam verändert sich die Bewohnerschaft auch hier. „Ich merke das an der Zahl der Zeitungen, die wir verkaufen und an den Lottoscheinen“, erzählt mir Chan, der seit etwa zehn Jahren den markanten halbrunden Rozi-Kiosk neben dem Ebert-Denkmal betreibt. „Das werden immer weniger. Durch Corona sind viele liebe Kunden gestorben. Es kommen mehr junge, Studenten und so.“

Bleibt zu hoffen, dass der Dornröschenschlaf, in dem große Teile der Siedlung liegen, nicht zum schleichenden Verfall wird. „An den Häusern selber ist lange nichts gemacht worden“, klagt Herr J. Der 50-Jährige stammt aus Slowenien und ich treffe ihn, als er auf einer der halbrunden Metallflächen sitzt, die hier jeden Eingang zieren. Sieben Jahre wohnte er hier. „Schauen sie sich die Metallfenster an! Das sind immer noch die alten.“ Und der Garten sei verwahrlost, beschwert er sich. „Aber wenn was kaputt ist, braucht man nur anzurufen, dann kommen sie schnell“, räumt er ein, ohne sich zu erinnern, wer eigentlich sein Vermieter war. Weggezogen – ins Märkische – ist er dann auch nicht wegen der Baumängel, sondern weil es mit der Liebe aus war. Heute ist er wieder da, um seine Ex-Freundin zu besuchen, die in der alten Wohnung geblieben ist. Liebe vergeht, Miete besteht.