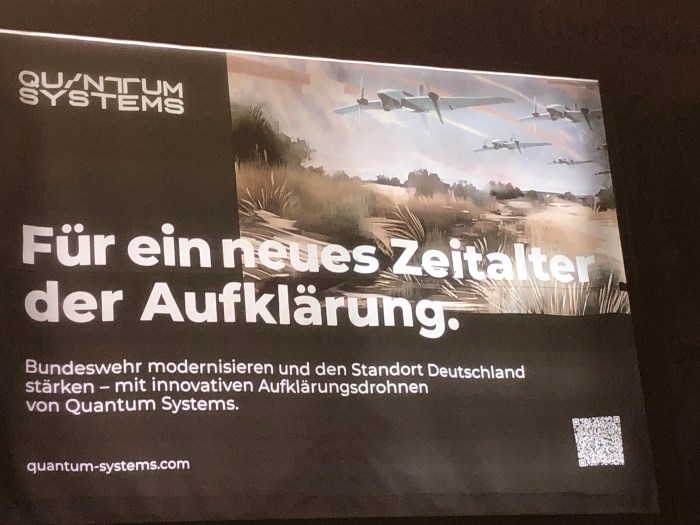Na, ist noch jemand zu Hause? Oder sind alle draußen im Grünen bei dem schönen Wetter?
Also mein Freund und ich waren nach dem Feiertag (ja, Berlin hat die Befreiung von Krieg und Naziherrschaft am 8. Mai mit einem Feiertag begangen) mit dem Rad unterwegs. Von Frankfurt/Oder durchs Schlaubetal nach Eisenhüttenstadt und zurück. Die „Mönchstour“, weil man dabei am Kloster Neuzelle vorbeikommt. Ja, war wieder schön gewesen. Hier ist Brandenburg so ein bisschen wie da wo ich herkomme. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Die Schlaube ist ein kleiner Bach, an dem früher viele Mühlen und Eisenhämmer betrieben wurden. Heute sind das Biergärten. Wir kehren gleich beim ersten ein, nachdem wir den Schreck am Bahnhof Frankfurt hinter uns haben: Viel Polizei in voller Montur. Grenzkontrollen an der Friedensgrenze zu Polen. Und das auf nüchternen Magen. Wir sind unverdächtig. Und nachdem ich mich bei der Bäckereiverkäuferin, die tapfer das babylonische Sprachgewirr ihrer Kundschaft meistert, mit einer Bockwurst versorgt habe, die so fade, fett und verkocht schmeckt, dass ich mich sofort wohlig in die alte DDR zurückversetzt fühle (noch schlimmer sind nur die, die man in Polen kriegt), suchen wir gleich die erste Gelegenheit, um den Geschmack aus dem Mund zu bekommen. Ist viel passiert hier, seit ich das letzte Mal da war. Neue Fußgängerbrücke, geteerte Fahrradwege und keine Menschen mehr auf den Straßen. Alles leer, auch im Biergarten, der ein Idyll ist. Es klappert.. (siehe oben). Eigentlich ist geschlossen. „Ich kriege ja kein Personal mehr.“, klagt die weißhaarige Mühlenwirtin. „Nur noch Ukrainerinnen, die was schwarz neben dem Bürgergeld verdienen wollen.“ Ob‘s noch ein Bier gebe, fragt mein Freund. „Ein Bier gibt‘s immer.“, ist die joviale Antwort, und schon stehen zwei „Radler“ in schimmernden Glaskrügen vor uns. „Aber den Blütenstaub kann ich nicht auch noch von den Tischen wischen.“
Und heiter gehts weiter. Solange wir uns an die ausgeschilderte Route halten (das Zeichen, dem wir folgen ist ein Mönch, der gemütlich auf seinem Fahrrad schlingert) ist‘s auch wirklich nett, dunkel, üppig und voller Nachtigallen. Aber als wir einmal falsch abbiegen, sind wir wieder in der Brandenburger Wirklichkeit: Staubige, kahle Äcker, leere Dörfer, die aus einem Baumarktkatalog zusammengebaut zu sein scheinen und kläffende Hunde hinter Zäunen. Mir tut mein Knie weh. Unsere Rettungsinsel ist das Kloster Neuzelle. Eine barocke Pracht, die man eher aus Bayern kennt. Geht auch in Brandenburg. Und selbstgebrautes Bier gibt‘s auch: „Schwarzer Abt“. Danach schlingern wir wie der Mönch auf unseren Rädern nach Eisenhüttenstadt, der „ersten sozialistischen Stadt auf deutschem Boden“ – heute das größte Flächendenkmal Europas. Menschenleer, wie die Dörfer drumherum. Aber das Stahlwerk arbeitet noch. Ein Geruch nach Koks und kaltem Kamin, wie ich sie noch aus meiner ersten Berliner Wohnung mit Ofenheizung kenne, liegt schon Kilometer vorher in der Luft. Eigentlich hätten wir stilgerecht im Hotel „Lunik“ absteigen müssen, ehedem das erste Haus am Platze, aber das Lunik ist eine Ruine. Also wird es das Hotel „Berlin“, das einzige Hotel, das es in der Stadt noch gibt. Der Empfang ist solide und herzlich. „Ham‘ ses doch noch jeschafft.“, kumpelt die Empfangsdame, die ich von unterwegs angerufen hatte, weil wir uns ja verfahren hatten. Sie empfiehlt uns das deutsche Restaurant nebenan, in dem es grabesstill ist und nach kaltem Frittenfett riecht. Also gehen wir zum Griechen, gleich unten im Keller. Hier brummt der Laden, Familien mit Kindern feiern (Jugendweihe?) und die Lammkotteletts schmecken wie Schuhsohle. „Nimm Essen mit, du fährst nach Brandenburg.“, singt Reinald Grebe.





Am nächsten Tag, dem Samstag, treffen wir nur nette Menschen in unserem Alter. Ist wirklich so. Keine Ahnung, wo die anderen abgeblieben sind, die Jungen, die Familien, die ganz Alten. Vielleicht interessieren sie sich nicht für das Museum „Utopie und Alltag“, das in einem ehemaligen Kindergarten untergebracht ist. Und eigentlich hat das Museum auch noch zu. Aber ein Herr in unserem Alter steht davor, er ist Maler (hab noch bei Tübke in Frankenhausen das Bauernkriegsfries mitgemalt; 3,50 Meter davon sind von mir…) und Mitglied des Museumsbeirates, der sich früh trifft und nachdem die Computer und die Lichtanlage hochgefahren sind, weist uns eine beflissene Frau in unserem Alter in die Dauer- und die Sonderausstellung (Völkerfreundschaft) ein. Es ist wirklich ein gut kuratiertes Museum über die Alltagskultur der DDR. Es gibt ja einige, in denen nur ein paar Küchengegenstände aus Plaste und ein Schwalbe-Moped in eine Scheune gestellt werden. https://www.utopieundalltag.de/

Als ich nach dem Ausstellungsplakat zur „Fremde Freunde“ frage, kriege ich die Antwort: „Ist aus. Wir drucken das gerade nach. Die waren ganz schnell vergriffen.“ Völkerfreundschaft an der Friedensgrenze? Im Landkreis an der Oder hat die AfD im Februar 39,1 Prozent geholt. Wo sind die ganzen Nazis? Sitzen die alle zu Hause? Auf dem Radweg auf dem Oderdeich treffen wir nur freundliche Leute (unseres Alters) in Funktionskleidung auf Elektrorädern. Einer erklärt mir die Industrieruine, die hinter dem Deich auftaucht: Das war ein Kraftwerk, das die Nazis haben bauen lassen, weil sie hier mitten im Krieg eine große Chemiefabrik errichten wollten. Die Deutschen haben sich hier in den letzten Kriegstagen verschanzt, die Russen haben sie zusammengeschossen, als sie über die Oder sind. War da heute nicht was? Genau: 9. Mai, 80 Jahre Kriegsende. An einem sowjetischen Kriegerdenkmal halten wir an. An Kriegerdenkmälern hat es in Brandenburg keinen Mangel. Aber das ist das einzige, so weit ich mich auskenne, das für sowjetische Matrosen errichtet wurde. „Schwarzmeerflotte, ewiger Ruhm den Helden, die für die Freiheit der Sowjetunion und der Heimat… so weit reicht mein Russisch immer. Sie sind mit ihrem Boot in der Oder ertrunken. Arme Kerle. Auf dem Sockel liegen ein paar kümmerliche Nelkensträuße. Nebendran bietet ein fliegender polnischer Blumenhändler seine Ware an. Mit dem Wort „Schnittblumen“ kann er nichts anfangen. Ich kaufe eine rote Geranie im Topf für 2,50 Euro und stelle sie auf den Stein. Dank euch, ihr Sowjetsoldaten.

Ein paar Kilometer flussabwärts wird es dann richtig konkret mit der Völkerfreundschaft. In Aurith ist heute Deutsch-Polnisches Volksfest. Hier gibt es eine Fähre über die Oder (wenn der Fluss genug Wasser hat) und die Mädchen der „Oderwendischen Volkstanzgruppe“, nicht zu verwechseln mit den Sorben, wie ich belehrt werde, mümmeln Bratwurst vor ihrem Auftritt. „Bei den Polen ist heute noch viel mehr los.“, versucht mich ein EU-gesponserter Tourismusbeauftragter auf die andere Seite zu locken. Aber mein Freund will nach Hause. Immerhin erfahre ich bei der Tourismusinfo auch, dass das „Lunik“ in Eisehüttenstadt wieder aufgebaut wird. Diesen Sommer beginnt es als provisorische Theaterspielstätte. „Sie müssen unbedingt kommen, und unbedingt vorher die Führung durch das „Lunik“ mitmachen!“ charmiert eine Theaterbegeisterte aus Eisenhüttenstadt, die ausnahmsweise nicht in unserem Alter ist. Na, dann muss ich da wohl nochmal hin.
Auf dem Rückweg treffen wir dann doch noch einen Nazi, einen verklemmten. Er kommt auf einem schwarzen BMW-Motorrad mit Beiwagen daher, wie eine Motorradpatroullie der Wehrmacht. Es soll eine BMW R 71 aus Vorkriegsproduktion sein, was er da fährt, aber es ist eine mit versteckten Runen und Frakturbuchstaben umlackierte sowjetische Kopie, eine M72 Molotov. Da kenne ich mich aus. Hatte selber mal so eine, aber in lila!
So ist das mit den Nazis heutzutag: Alles eine russische Kopie.