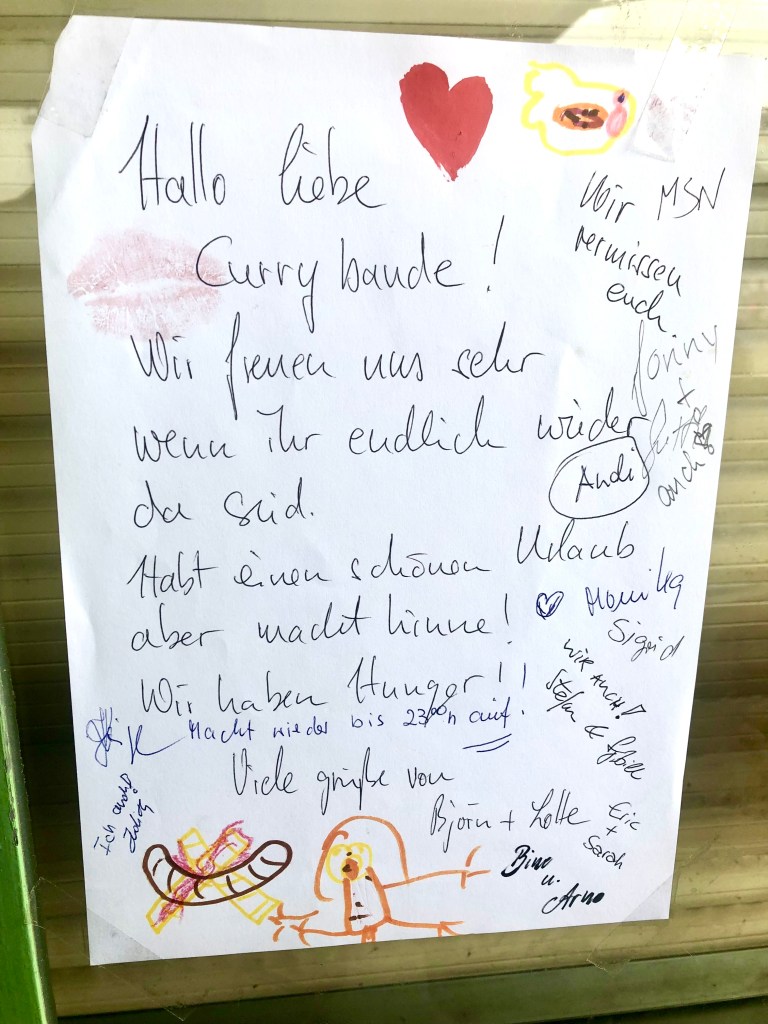Es ist Sonntagmorgen um 12 Uhr in der Müllerstraße. Ich knattere mit meinem Moped ziellos durch die Straßen. Die Cafes und Imbissbuden gähnen leer vor sich hin und auch auf der Straße ist nichts los. Kaum Verkehr. Nur vor einem Laden stehen Menschen: An der runden Ecke zur Liverpooler Straße hängen grüne und silberne Luftballons über der Türe des Waschsalons, der lange Zeit geschlossen war. Und es sind jede Menge Kunden da, die drinnen ihre Wäsche in die Maschinen stopfen. Draußen vor dem Laden warten Männer, bis ihre Wäsche trocken ist. Die großen silbernen Trommeln drehen sich wieder.
Ich wollte immer mal in einen Waschsalon. Wer die 1980er Jahre erlebt hat, erinnert sich an die kultige Levi’s‑Jeanswerbung, in der ein gut gebauter junger Mann sich unter den staunenden Augen der weiblichen Kundschaft in einem Waschsalon aus seiner hautengen Hose schält, oder an den Film von Stephen Frears “Mein wunderbarer Waschsalon”, in dem eine Wäscherei für einen Migranten aus Pakistan und seine Freunde im kalten London der Thatcher-Zeit zum Hoffnungsort wird. Besungen wurden die Salons in der Zeit auch gerne. Im experimentellen Industrial-Stück “Berliner Waschsalon” von Frieder Butzmann oder im fröhlichen Rocktitel “Isch jon so unwahrscheinlich jehn mit dir in de Waschsalon” der Kölner Rock-Band BAP. Die Salons galten als cooler Treffpunkt von unangepassten Helden, die garantiert ihre Wäsche nicht mehr bei Mutti waschen ließen. Vor allem nachts glänzte ihr Licht hell und machte sie zu Inseln des großstädtischen Lebens und zum sicheren Ort für ungewöhnliche Begegnungen von schrägen Vögeln, einsamen Herzen und verlorenen Seelen. Mein Waschsalon war im Keller unseres Schwesternwohnheims. Hier traf man vor den robusten Miele-Waschmaschinen nur Leute, die man auch bei der Arbeit traf. Aufregende Begegnungen hatte ich mir anders vorgestellt. Später sollten die Salons gemütliche Kiez-Wohnzimmern sein, wie Freddy Leck in Moabit. Aber da hatte ich schon längst eine eigene Waschmaschine, die wir ununterbrochen mit Baumwollwindeln beschäftigten, bis wir es satt hatten, und auf billige Papierwindeln umstiegen, die uns ein Freund vom Laster auf dem Polenmarkt besorgte. In unserer Straße gab es einen von der EU geförderten Waschsalon, der als sozialer Begegnungsort aufgebaut werden sollte. Aber tagsüber wurde man von Nachbarskindern angebettelt, die von ihren Eltern nichts zu Essen mit in die Schule bekommen hatten (und die man 50 Cent für eine Packung trockener asiatischer Tütennudeln glücklich machen konnte) und nachts wurden die unbeaufsichtigten Maschinen immer wieder durch Vandalismus zerstört. Nach und nach gingen in dem Salon die Lichter aus.

Nun also ein Neustart. Vor dem Salon treffe ich Andy, der eine Dreiviertelstunde warten muss, bis seine Maschine fertig ist. Er ist Ende 20, sportlich, Basecap und Jeans, arbeitet in der Gastronomie. Er ist mit seinem kleinen Sohn da. Seit zwei Jahren wohnt er bei einem guten Freund im Afrikanischen Viertel und sucht eine Wohnung hier, in der für ihn und seinen Sohn Platz ist. Bislang Fehlanzeige. Er ist froh, dass der Waschsalon wieder aufgemacht hat. Und es sei besser als vorher. “Der alte Laden hatte zwar gute Maschinen aus Schweden, aber Probleme mit dem Wasser. Da war manchmal Dreck drin, der dann auch in die Wäsche gekommen ist.” Es sind erstaunlich viele Männer hier. Die einzige Frau im Laden legt die Wäsche für ihren alten Vater zusammen. Der Vater erzählt mir, dass er seit 20 Jahren in einer kleinen 1,5 Zimmerwohnung wohnt, eine Dienstwohnung der Bundeswehr in der Cité Jofre. Da passe keine Waschmaschine rein. Aber er komme gerne hierher, sagt der ehemalige Soldat, auch wegen der Gesellschaft. Aber nicht nur Menschen, die keine eigene oder nur eine kleine Wohnung haben, gehören zur Kundschaft, die für 5 Euro 50 bis zu 6,5 Kilo Wäsche sauber mit nach Haue nimmt. Ein Nachbar, nennen wir ihn Wolfgang, ist heute mit seinem Bettzeug da. “Wenn sie alles auf einmal in eine Waschmaschine stecken wollen, dann kommen sie besser hierher. Und es geht auch schneller, denn zu Hause habe ich keinen Trockner.”
Angefixt von dem zufällig Gefundenen, mache ich noch am Abend eine Tour durch die Handvoll anderen Salons im Wedding. Was ich finde ist ernüchternd: Ein paar verlorene junge Männer und ängstliche ukrainische Frauen in kleinen Ladengeschäften, die vollgestopft sind mit einer notdürftig zusammengewürfelten Ansammlung von grauen Kisten mit verwirrenden Bedienungsvorschriften und vielen Verbotsschildern.
Immerhin hat die Pop-Kultur den Waschsalon wiederentdeckt. Schon von zehn Jahren nutzte Gott persönlich in der belgischen Komödie “Das brandneue Testament” einen Waschsalon als den geheimen Ort, an dem er vom Himmel auf die Erde kommt. Und im letztjährigen Oscar-Preisträger-Film “Everything everywhere at once” ist ein Waschsalon die Einstiegspforte für eine Parallelwelt, in der ein Kampf von Gut gegen Böse ausgefochten wird. Ein neues Abenteuer lockt. Ich geb den Salons also eine letzte Chance. Ich lass Waschmaschine mal eine Pause machen und geht in den Salon um die Ecke. Die Bettwäsche meiner Jungs braucht dringend eine Grundsanierung, auch weil einer gegen Staub allergisch ist. Und ich will wieder mal was erleben.