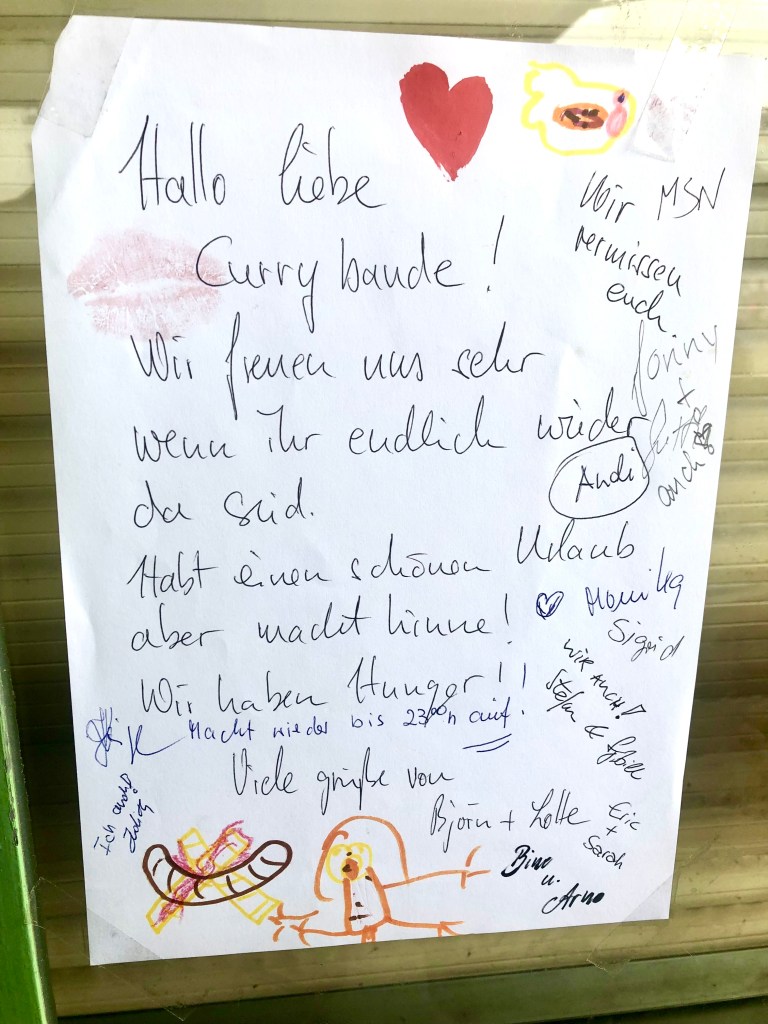Samstagmittag. Wir sitzen beim Döner. Meine zwei Jungs, ihr Freund und ich. Sie haben sich in der Bibliothek einen Harry-Potter Film und zwei Kilo Donald Duck-Hefte ausgeliehen und sie haben sich bei mir einen Filmnachmittag herausverhandelt. Die Stimmung ist aufgekratzt. Aber erstmal gibt es was Ordentliches zu essen und zu lesen. „Papa, du hast doch die Geschichte mit dem ICE geschrieben. Kannst du die mal vorlesen?“, heißt es, kaum dass wir am Tisch sitzen. Die Jungs sind der festen Überzeugung, dass ich meinen Blog nur schreibe, um meine Erlebnisse mit ihnen und ihrem Bruder für die Nachwelt zu erhalten, was nicht ganz falsch ist. Manchmal lese ich ihnen nach einem gemeinsamen Abenteuer vor, was ich getippt habe. „Ich würd dich instant liken“, sagte der eine mal abends, als ich wieder eines unserer alltäglichen Dramen in Worte gegossen hatte. Und ich denke, das ist ein Lob. Aber das hier ist ist jetzt was anderes. Das ist in der Öffentlichkeit. Der Freund ist dabei, die zwei Döner-Männer hinter der Theke und ein Pärchen in unserem Rücken, das sich nebenan einen Lamachun geholt hat, weil das billiger ist als ein Döner. Wenn ich jetzt die Geschiche vorlese ist das eine öffentliche Lesung! Vor Publikum! Natürlich drängt es jeden Autor dazu, seine Werke der Welt anzuvertrauen, und bisher habe ich erst einmal die Gelegenheit dazu gehabt, bei einem mäßig besuchten Leseabend an meiner Arbeitsstelle. Es war schnell vorbei, gab eine Flasche Sekt zur Belohnung und zwei Monate später die Überraschung bei einer Arbeitssitzung mit einer anderen Abteilung, als eine Kollegin sagte: „Sie sind doch der, der vorgelesen hat. Ich hab sie an ihrer Stimme erkannt.“ Da schmiedet man stundenlang ein Schmuckstück aus Worten, und sowas bleibt also in in Erinnerung. Mein heutiges Publikum kennt meine Stimme zur genüge in allen Lagen und Lautstärken. Aber sie wollen mit meiner Hilfe ihren Freund beeindrucken. „Fang doch jetzt endlich an mit der Geschichte.“, drängt mich mein Sohn, während ich noch an meinem Adana Dürum kaue – und sie ihren Döner in Lichtgeschwindigkeit abgenagt haben. Auf dem Tisch und darunter sieht es aus wie nach einem Wirbelsturm. Aber ein wahrer Künstler muss der richtigen Stimmung sein, um sein bestes zu geben. Also bestelle ich mir noch einen Tee und ziehe langsam das Handy aus der Tasche. „Die Stimmung war gut…“ beginne ich mit der epischen Einleitung. Der Freund kommt neugierig auf meine Seite, aber die Jungs drängeln: „Muss das sein? Lass das doch weg. Kommt das auch mit der U-Bahn?“. Kunstbanausen. Hatten sie sich nicht neulich beschwert, dass ich sie in ihrer Jugend betrogen hätte, weil ich bei den ewigen Wickie der Wikinger-Geschichten beim Vorlesen ganze Absätze unterschlagen hätte? Also müssen sie sich jetzt gedulden. Genüsslich komme ich zum ersten Cliffhanger: „Was ich nicht wusste: Sie hatte sich neue Verbündete gesucht…“ Der Döner-Wirt kommt mit mürrischem Gesicht und versucht die Ordnung auf unserem Tisch wieder herzustellen. Das Pärchen hinter uns kaut unbeeindruckt an seinen Teigrollen. Am Glückspielautomaten im Hinterzimmer ist jetzt ein Biertrinker zu Gange. Der Laden füllt sich. Wahre Kunst findet immer ihr Publikum. Aber nicht immer ein dankbares. Ständig spoilern meine Jungs vor lauter Aufregung kichernd die Pointen. „Das stimmt doch gar nicht.“ Wir hätten noch mehr Cola aus dem Bisto holen können“. „Sind wir wirklich schwarz gefahren in der U-Bahn?“ Dem Freund wird langweilig und mein Schlussatz geht unter, weil die drei schon wieder bei einem anderen Thema sind. Wahrscheinlich ob sie zum Film lieber Popcorn oder Chips bei Edeka kaufen sollen. Ich drücke ihnen einen Zehner in die Hand und scheuche sie zum Supermarkt. Der Künstler bleibt sitzen und genießt den kurzen Ruhm. Nach zehn Jahren Bloggerei endlich der ersehnte Erfolg. Eine treue, wenn auch bestechliche Anhängerschaft und einen Platz in der Ewigkeit. Hatte mein Älterer nicht eben an der Ampel gesagt: „Irgendwann schreib ich ein Buch über dich“?