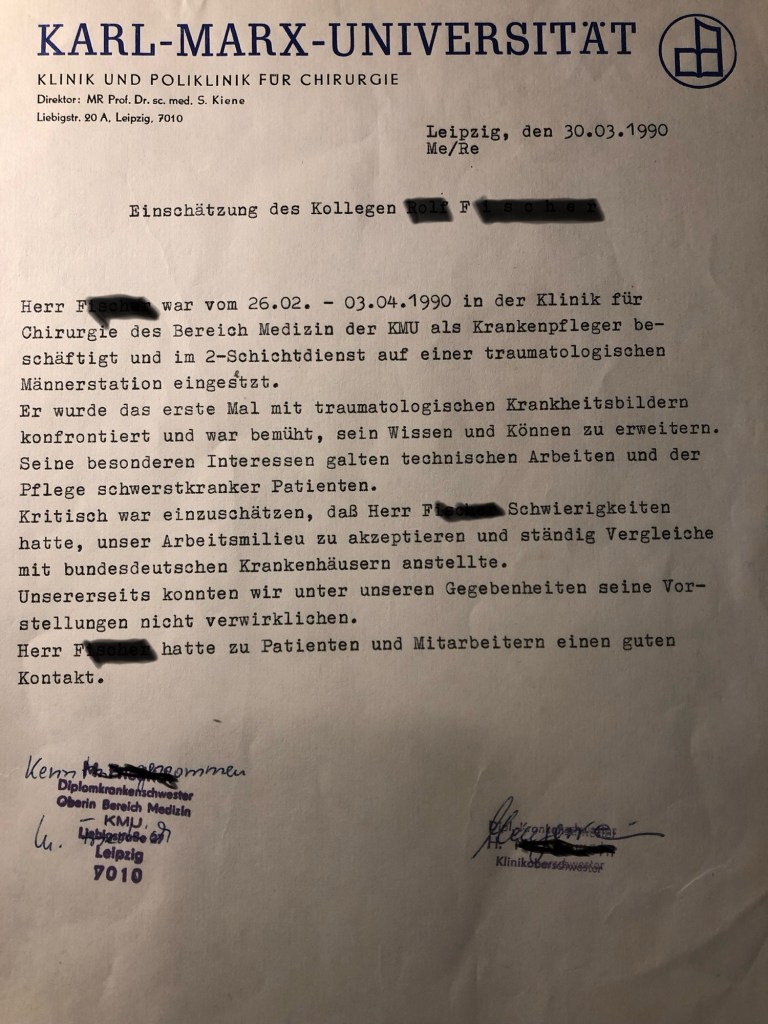Es ist Herbst, die Zeit, in der das Leben sich verabschiedet und wir uns vorbereiten auf die karge Zeit, die vor uns liegt. Und während der Landmann die Früchte des Jahres in die Scheuer fährt und mit eisernem Pflug den Acker umbricht, schwinge ich mich auf mein Moped und fahre mit den letzten Sonnenstrahlen zum letzen Postamt in unserem Viertel. Auch wenn das Erntedankfest schon lange Vergangenheit ist, hoffe ich eine Ernte einzufahren, die Ernte fast 10 Jahren eifrigen Sparens und auch ich will mich verabschieden: Von meinem Postsparbuch, das mich begleitet, seit ich 16 wurde. Es ist kein leichter Abschied. Und er ist nicht freiwillig.
Ein Sparbuch bei der Post, das war in den späten 1970er-Jahren ein Ticket in die Freiheit. Ohne ein Konto zu eröffnen, was die Unterschrift der Eltern verlangt hätte, konnte ich mein Geld einzahlen, das ich in der Fabrik, mit Zeitungsaustragen und Nachhilfestunden verdient hatte und konnte bei jedem Postamt in ganz (West-)Europa Geld abheben. Kostenlos. Keine Eurochecks, keine American Express Travelerschecks, keine Kreditkarte. Und es klappte wirklich überall. Im Dorfpostamt im County Galway und im prächtigen marmornen Postpalast von Bologna (oder war es Perugia?) In Schottland und in Alicante. Später sogar in Hoyerswerda und im Hauptpostamt Leipzig, von wo ich Telegramme in den Westen schickte. Aber da war die Welt schon eine andere.
Ich bin der Post immer treu geblieben, auch als es dann EC-Karten und Geldautomaten gab. Die Post sich selber leider nicht. Es war das erste Mal in Manchester, in den späten 1980ern, als ich einem Brief in einen Schreibwarenladen aufgeben musste, der nachlässig ein Pappschild „Post Office“ ins Schaufenster gelegt hatte. Die Royal Mail hatte den Service „privatized“. Mein Weltbild war endgültig erschüttert, als ich sah, dass man auch Telefone dort einfach so kaufen konnte. Wozu fragte ich mich? Wer einen Telefonanschluss bei der Bundespost beantragte, der bekam das Telefon -grau und stabil – doch gleich mit dazu. Andere Telefone, bunt und mit Tasten und ohne Prüfung und Zulassungssiegel der Deutschen Bundespost: Das konnte doch nichts taugen. Wie für W. I. Lenin war für mich die Deutsche Post das Maß aller Dinge.
Die Frau hinter dem Schalter ist weißhaarig. Ihr müder Kollege am Schalter daneben und die kleine Frau, die im Lagerraum ein Paket wegträgt auch. Es sind wohl die letzten Postbeamten des Wedding. Und auch vor dem Schalter: alte Leute wie ich, wenn man mal von denen absieht, die Pakete nach Vietnam oder in die Türkei abgeben wollen. Gibt es eigentlich den „Postrentendienst“ noch, mit dem früher pünktlich zum Monatsersten alle Rentnerinnen und Rentner ihr Ruhegeld am Schalter bekamen? Was es auf jeden Fall noch gibt, ist der behördliche Tonfall. Wie in den alten Zeiten werde ich erstmal angepflaumt: „Ihr Sparbuch auflösen? Da wären se mal besser vor 14 Uhr jekomm!“ Davon stand nichts in der Nachricht der Postbank, die mir mitgeteilt hatte, dass sie „…den Service Postsparbuch…“ in Kürze einstellen will. Aber weil das Berlin ist kommt nach der Schnauze das Herz, und die Frau hinter dem Schalter macht sich mit einem sarkastischen „Na, dann jeben se mal her.“ trotzdem an ihre traurige Pflicht. Sie tippt, lässt sich meinen Ausweis geben und ein Drucker fiept. Ein kleiner weißer Kasten, der noch so solide aussieht als sei er aus der BTX-Zeit der Bundespost, spuckt viele weiße Zettel aus, die die Postfrau akkurat mit viel Theater auf die grauen Seiten meines Sparbuchs klebt. „Was das alles für ein Abfall macht…“, seufzt sie. Es ist eine lange Prozedur und ich glaube, sie fühlt genau wie ich, dass wir beide hier etwas tun, was uns bald fehlen wird, dass wir ein sinnlos gewordenes Ritual aus längst vergangenen Zeiten ein letztes Mal gemeinsam zelebrieren. 2016 hatte ich noch einmal persönlich etwas eingezahlt. Seitdem lag das Buch in der Schublade. Von 2009 bis 2015 wurde die Postbank nach und nach von der Deutschen Bank übernommen. Was der Drucker ausspuckt ist ernüchternd: Bis 2017 gab es jedes Jahr noch ein paar Euro Zinsen und einen extra Bonus für treue Sparer. Zwischen 2018 und 2022 waren es noch 7 Cent Zinsen – pro Jahr – und Boni gab nur noch für die Manager der Deutschen Bank. „Das sind mehr als 0,01 %,. Da könn se sich nich beschweren.“, nimmt mir die erfahrene Kundenbetreuerin mir meine Enttäuschung aus dem Mund und haut noch einen drauf: „Is ja besser als nix.“ Langsam ahne ich, wer die Kosten der Bankencrashs von 2008 bezahlt hat.
Aber auch die paar Cent müssen natürlich genau verbucht werden. Da ist die Postfrau noch richtig amtlich. Die Seiten in meinem Sparbuch reichen nicht. Aus grauem Papier legt sie Extraseiten an und stempelt sie einzeln ab. Ganz zum Schluss schneidet sie die rechte untere Ecke ab und geht nach hinten. Ich höre den harten Knall eines eisernen Handstempels, wie man ihn nur in der Post hören kann, dann bekomme ich das Buch zurück.“Entwertet“ steht jetzt auf der letzten Seite. „Warten se noch ne Woche, bevor sie das Buch ihren Enkeln zum Spielen jeben.“, verabschiedet sie sich. „Dann sollte das Geld auf ihrem Konto sein.“, gibt sie mir auf den Weg und es klingt so, als würde sie es selbst nicht glauben. Es ist viel schief gelaufen bei der Deutschen Post, seit sie wiedervereinigt und privatisiert wurde und das sitzt der gestandenen Postbeamtin in jeder Falte ihrer dünn gewordenen Dienstbluse.

Auf dem Rückweg durch die lange Halle mit der gar nicht mehr so langen Schlange der Wartenden komme ich an einem Ständer mit Postkarten vorbei. 50 Prozent Nachlass gibt es bis zum Jahresende auf auf kitschige Hochzeits- und schwarz-weiße Trauerkarten. Vielleicht verabschiedet sich die Postbank nur von ihrem Papiergeschäft, das sie nebenbei in der Filiale betreibt. Vielleicht verabschiedet sie aber auch gleich von ihrer Filiale und Ihren letzten Beamten. Meine Pakete gebe ich schon seit Jahren beim Zeitschriftenladen an der Ecke ab. Der wird von einem indischen Pärchen betrieben. Der Laden ist gerade zu. Die beiden sind wohl krank geworden.