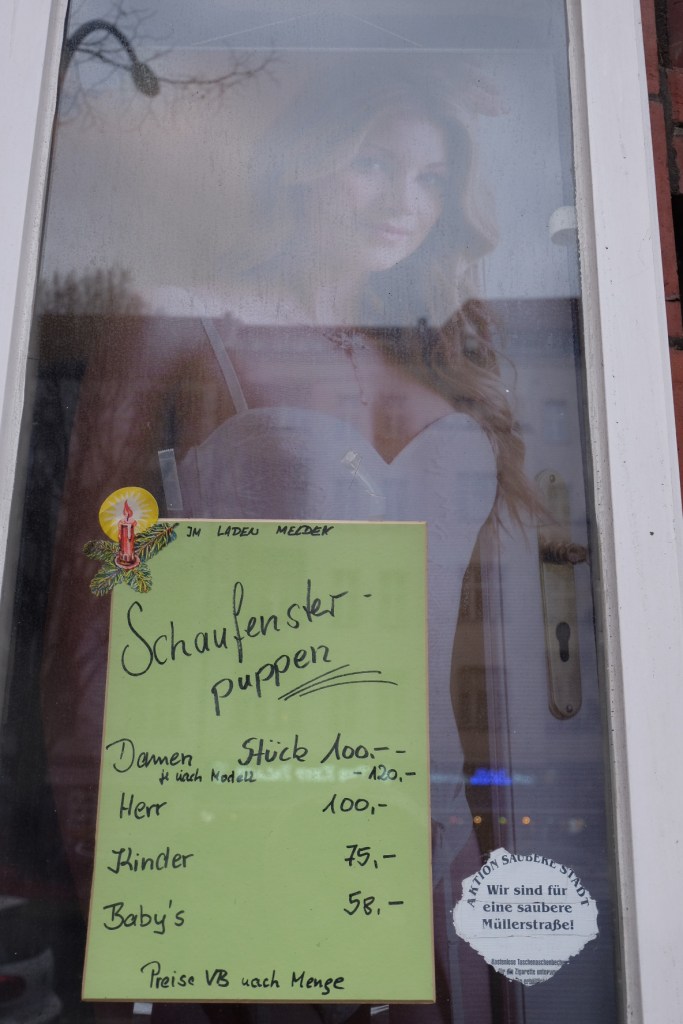Nein, heute gibt es nichts Neues im Blog. Ist zu spät und ich habe zu viele böse Briefe geschrieben. An Leute, die noch weniger vom Fach verstehen als ich. Und das will was heißen. Außerdem war es ein grauer Tag. Ein grauer Wintertag mit Nieselregen und eiskalten Windböen wie es sie nur in Berlin gibt: Aus allen Richtungen. Das wär ja nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht schon seit einer Woche so grau wäre, und wenn ich nicht zum Zahnarzt gemusst hätte. Und das wär nicht so schlimm gewesen, wenn wenigsten die U-Bahn gefahren wäre. Ist sie aber nicht. Die Strecke sollte schon vor einer Woche wieder klappen, aber heute seh ich wieder die gleichen müden Massen an der Ersatzbushaltestelle. (Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht..) Also wieder kehrt gemacht, das Fahrrad rausgeholt. Wenn man erst mal drauf sitzt, ist es ja nicht mehr so schlimm mit dem Wind und dem Regen und der Kälte. Sind ja nur 10 Kilometer quer durch die Stadt. Was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn wenigstens alle wirklich wegen Corona zu Hause geblieben wären. Sind sie aber nicht. Alle sitzen im Auto, weil ja die U-Bahn nicht fährt und man sich im Ersatzbus den Tod holt. Inzidenz 3000 in Berlin-Mitte. Was auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn nicht noch die wummernden LKWs und die Martinshörner von hinten gekommen wären, was mich auch nicht gejuckt hätte, wenn es an der Müllerstraße wenigstens einen Radweg gäbe und nicht die vielen Ersatzbusse einen eingedieselt hätten. Doch auch da wäre ich schnell durch gekommen, wenn der Hinterreifen nicht die Luft verloren hätte. Also mit voller Kraft treten um mit halber Geschwindigkeit zu fahren. Aber pünktlich angekommen. Und natürlich war die Zahnärztin krank und an ihrer Stelle ein weißhaariger Vertreter im Dienst. Ich weiß nicht, aus welchem Ruhestand die Ärztekammer ihn geholt hat, aber als er mich, als ich mit Helm, nasser Jacke und beschlagener Brille ins Behandlungszimmer komme, fragt, ob ich mit dem Fahrrad da wäre, wusste ich: Das wird nix mit uns. Wir haben es tapfer hinter uns gebracht, und ich glaube, er war darüber mehr erfreut als ich. Eine Stunde später kam der Anruf, dass der Abguss nichts geworden ist, und ich morgen noch mal kommen muss. Aber das wusste ich ja noch nicht, als ich vor der Praxis stand und sah, dass das Rad natürlich endgültig platt war. Was mir aber egal war, weil vor mir jetzt der schönere Teil des Tages lag: Bergab zur Markthalle, wo ich mir immer nach dem Zahnarzt einen guten Kaffee und was Süßes gönne. („I gonna have a candy bar!“ Kennt das noch jemand aus “Little Shop of Horrors“?)
So, ich hoffe, dass ich das was jetzt kam noch einigermaßen zusammenbekomme, denn ist ja wirklich schon spät, und es war ein anstrengender Tag. Ich hoffe, das ist bis jetzt so rübergekommen. Ja, um es kurz zu machen: Dann war da diese Frau, diese Italienerin, diese Naturgewalt, diese Mama Roma. In der Marheinekehalle gibt es einen neuen Stand, irgendwas mit cuccina italiana. Da gibt es eben nicht nur allerfeinsten Cappucino, sondern auch sie! (Ich habe mich noch nicht mal getraut nach ihrem Namen zu fragen) Wie aus dem Film entsprungen, den ich gestern Abend gesehen habe. „Verliebt in scharfe Kurven“ aus dem Italien der frühen 60er mit dem jungen Jean Louis Tirtingnang (oder so, ich hab jetzt wirklich keine Zeit mehr zum Googeln), der einen schüchternen Jurastudenten spielt. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig. Aber der Film war schwarz-weiß. Und diese Frau war Farbe. Rot vor allem. Rotes, eng anliegendes Kleid, rot gefärbte Haare und rote Fingernägel. „Hier kommst du nur rein, wenn du grün bist.“ war der einzige deutsche Satz, den ich von ihr hörte. Und sie meinte damit meinen Corona-Test. Den Rest der Zeit verhandelte sie mit zwei Landsleuten, die ihr Ware geliefert hatten und scheuchte ihren Gehilfen durch die Gegend. Laut, wie es nur Italienerinnen sein können. Ich war ihr so dankbar. Denn durch sie war ich augenblicklich auf einer italienischen Piazza. Der Lärm, der gute Kaffee, die vielen Hände und Arme, die sie brauchte, um klar zu machen, was sie von den Männern wollte. Ich war im Urlaub, für die Länge eines Kaffees und eines panni caldo (von dem ich mich wunderte, dass sie es in den Ofen schob. Ich war zu lange nicht mehr in Italien, um zu wissen, das caldo nicht kalt sondern heiß heißt.)
Abends rief die Mutter meiner Söhne an und fragte, ob wir Ostern nicht einfach eine Woche verschwinden könnten. Egal wohin. Die Kinder würde sie an ihre Mutter verschicken. Ja, sagte ich, gern. Mailand oder Madrid: Hauptsache Italien. Sie kannte den Witz nicht.